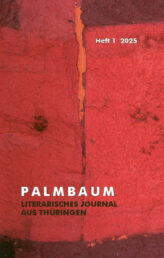
Cover mit einem handgeschöpften Papier von Marita Kühn-Leihbecher
Heft 80
EDITORIAL
Wenn dieses Heft Sie, liebe Leserinnen und Leser, erreicht, dann haben sich die Bundesbürger eine neue Regierung gewählt. Wir fragen Sie nicht, für wen Sie Ihre Stimme gaben, so wenig wie wir vorab für eine oder einen der Kandidatinnen und Kandidaten Partei ergreifen. Wir folgen dem Rat unseres Kollegen Schiller, der aus seinen Horen alles verbannen wollte, »was mit einem unreinen Parteigeist gestempelt ist«. Obwohl es geistig durchaus anspruchsvoll wäre, die Streithähne, die sich gern rhethorisch aufplustern und mit Phrasen blenden, zu reinem Parteigeist zu nötigen, d. h. zu argumentativ klaren und verbindlichen Aussagen, welche Sachprobleme sie mit welchen Mitteln zu lösen gedenken.
Wir treten einen Schritt zurück und fragen nach dem »Politischen in der Literatur«. Nicht politische Literatur als Agitprop wird befragt, sondern die Eigenart, wie Literatur ins Politische eingreift, wie sie Erfahrungen zur Sprache bringt, die im Streit der Parteien kein Gehör finden, wie sie mit der Kraft der leisen Worte dem Reden und Gerede der Politik widersteht.
Anlass ist das Gedenken an 500 Jahre Bauernkrieg. Mit Volker Braun und B.K. Tragelehn, dem letzten Meisterschüler Brechts, melden sich lebenserfahrene Autoren zu Wort, Wilhelm Bartsch, der jüngst den Bremer Literaturpreis erhielt, schreibt über Arno Schmidt-Lektüre im Osten, Ulrike Müller über den Mystiker Müntzer, Dietmar Jacobsen über Hilbig und Heinz Hamm über die »gendergerechte Sprache« als vermeintlichen Staatsauftrag. Aus dem Nachlass von Gerhard Zwerenz erstveröffentlichen wir eine Gedichthandschrift. Neue Gedichte bringen wir u.a. von Thomas Böhme, Joachim Werneburg und Christian Steyer – der Stimme von »Elefant, Tiger und Co«. Von Harry Weghenkel erscheint eine Kostbarkeit: ein Sonettenkranz auf die Passion Christi.
Prosa bringen wir u.a. von Elisabeth Dommer und Olaf Trunschke. Unter Essay stehen Anmerkungen zur deutsch-deutschen Lage von Jürgen Große und Friedrich Dieckmann. Der Rezensionsblock umfasst wieder 20 Seiten, auf denen wir 18 Bücher empfehlen.
Der Einband ist eine Novität: ihm liegt nicht, wie sonst oft, eine Druckgrafik oder Zeichnung zugrunde, sondern handgeschöpftes Papier von Marita Kühn-Leihbecher. Wir haben sie und ihren Mann, den Plastiker Volkmar Kühn, im Kloster Mildenfurth besucht, einem verwunschenen Kunstort jenseits der großen Städte. Im Niemandsland, wo sich vielleicht die bevorstehende Wahl entscheidet …
Jens‑F. Dwars
Inhaltsverzeichnis
Editorial .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…… 7
Titelthema
500 Jahre Bauernkrieg:; Was ist und kann politische Literatur?
Jens‑F. Dwars: „Pfui, ein politisch Lied …“ .….….….….….….….….….….….….….….…. 9
Die zwölf Artikel der aufständischen Bauern von 1525 .….….….….….….….…. 13
Achim Wünsche: Von unten auf. Warum die Bauern sich erhoben .….….…. 19
Marion Dammaschke: 500 Jahre Bauernkrieg. Das Programm .….….….….… 21
Thomas Müntzer: Die Fürstenpredigt (Auszug) .….….….….….….….….….….….… 27
Ulrike Müller: „… tut Gott den Dienst und vertilget diese Oberkeit“
Thomas Müntzer und die Mystik .….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 35
Martin Luther: Wider die räuberischen Rotten der Bauern .….….….….….….. 51
Achim Wünsche: Luther versus Müntzer.
Idealtypen des Rechts- und Linksintellektuellen? .….….….….….….….….….….. 57
Johannes R. Becher: Riemenschneider .….….….….….….….….….….….….….….….. 62
Jens‑F. Dwars: Merkwürdige Verwandtschaft.
Johannes R. Becher, Thomas Mann und der Bauernkrieg .….….….….….…… 63
Klaus Hemmerle: Der arme Konrad von Friedrich Wolf .….….….….….….…… 69
B.K. Tragelehn: Brecht und die Folgen .….….….….….….….….….….….….….….….. 73
Zukunft der Erinnerung: Wie KI Celans Todesfuge dechiffriert .….….….…. 77
Wilhelm Bartsch: Arno Schmidt-Leser in der DDR .….….….….….….….….…… 81
Dietmar Jacobsen: Zu Wolfgang Hilbigs Erzählung
Die elfte These über Feuerbach .….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 87
Ulrich Kaufmann: Der Aufstand, der nicht stattfand.
Die hellen Haufen von Volker Braun .….….….….….….….….….….….….….….….… 93
Volker Braun: Ich werde nach der Revolution gefragt .….….….….….….….… 98
Gerhard Zwerenz: Realityshow. Gedicht aus dem Nachlass .….….….….. 101
Heinz Hamm: Gendergerechte Sprache als Staatsauftrag?
Angewandte Sprach-Politik .….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 105
Lyrik
Christian Steyer: Drei Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….… 117
Julia Kulewatz: Die Seehündin .….….….….….….….….….….….….….….….…. 120
Ulrich Kersten: Vier Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….…… 123
Ralph Grüneberger: Frühling, Europa .….….….….….….….….….….….…… 125
Ulf Annel: Die kleinen Nazilein .….….….….….….….….….….….….….….…… 126
Holger Brülls: Drei Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….…… 127
Joachim Werneburg: Der Mantel des Jaguars .….….….….….….….…… 129
Thomas Böhme: Ohrenbetäubend .….….….….….….….….….….….….….. 140
Harry Weghenkel: Kreuzweg. Sonettenkranz .….….….….….….….….. 141
Prosa
Elisabeth Dommer: Wurzelgeflecht .….….….….….….….….….….….….… 151
Olaf Trunschke: Frame 313 .….….….….….….….….….….….….….….….…… 155
Jens Grandt: Einmal die Eisberge sehen .….….….….….….….….….…… 161
Jens‑F. Dwars: Diese Welt .….….….….….….….….….….….….….….….….… 165
Essay
Günter Schmidt: Hundert Jahre Zauberberg von
Thomas Mann.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 169
Jürgen Große: Das Deutschland der anderen.
Schwierigkeiten mit dem Pluralismus .….….….….….….….….….….… 175
Friedrich Dieckmann: Die Lücke im Grundgesetz.
Das Kulturdefizit der deutschen Verfassung .….….….….….….…… 179
Zum Palmbaum-Umschlag
Jens‑F. Dwars: Verliebt in ein Kloster.
Zu Besuch bei Volkmar Kühn und Marita Kühn-Leihbecher .. 189
Rezensionen über Bücher von L. Scherzer, A. Koziol,
L. Rathenow, Th. Böhme, J. Hultenreich, J. Werneburg,
D. Gleisberg, F. Quilitzsch, J.F. Dwars, K. Groß-Striffler,
U. Völkel, B.-L. Lange, R. Hohberg, Th. Kuschel,
Ph. Kampa, H. Brülls, V. Paul-Zinserling und T. Prüwer .….….. 197
Aus dem literarischen Leben
Nachrichten .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 217
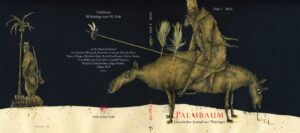
Die Zeitschrift »Palmbaum – literarisches Journal aus Thüringen« wurde 1993 von Detlef Ignasiak gegründet. Sie erscheint im quartus-Verlag Bucha. Bis 2015 erschien sie vierteljährlich und wurde von der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum herausgegeben.
Seit dem 2. Halbjahr 2005 gestaltet Jens-Fietje Dwars die Einbände der Zeitschrift, die seit 2006 halbjährlich erscheint, unter Verwendung von Graphiken und Zeichnungen zeitgenössicher Künstler aus Thüringen und darüber hinaus.
Seit dem Jahr 2016 gibt der Thüringer Literaturrat e.V. die Zeitschrift gemeinsam mit der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. heraus.
Die Zeitschrift erscheint halbjährlich, jeweils zur Buchmesse in Leipzig und in Frankfurt am Main. Sie wird vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gefördert . (2016–2024 von der Thüringer Staatskanzlei.)
Die Zeitschrift »Palmbaum« unterscheidet sich durch zwei Spezifika von vergleichbaren Journalen aus der Bundesrepublik Deutschland: zum einen durch die Einbindung von Geschichte und Kultur. Während andere Literatur-Zeitschrift in der Regel nur neue Prosa, Lyrik und Essays bringen, verbindet der »Palmbaum« das gegenwärtige literarische Leben von Anbeginn mit der Aufarbeitung des reichen kulturellen Erbes im Freistaat. Schon dadurch spricht sie ein breiteres Publikum an.
Zum anderen bindet die Zeitschrift neben der Literatur auch bildende Kunst der Gegenwart ein. Waren dies anfangs v. a. Thüringer Künstler, so öffnete sich Zeitschrift seit 2015 für Mittel- und ganz Deutschland. Thüringen bildet dabei nach wie vor den Schwerpunkt bleiben. Insgesamt versteht sich die Zeitschrift als Fenster, durch das man von außen in das kulturelle Leben des Freistaates und von innen in die »Welt« blicken kann.
Durch diese zweifache Doppelstrategie – Literatur der Gegenwart mit der Geschichte und mit bildender Kunst in und über Thüringen zu verbinden – bietet die Zeitschrift Raum für vielfache Anregungen und Entdeckungen.
Dennoch bleibt es dabei, dass Zeitschriften mit ihrer Zwitternatur zwischen Buch und Zeitung naturgemäß nur einen begrenzten Kreis von Lesern erreichen, die nicht nur an Tagesmeldungen und fertigen Büchern interessiert sind, sondern zugleich an dem spannenden, aber selten wahrgenommenen Prozess der Entstehung von Literatur, die sich langsam, in widersprüchlichem Ringen aus dem Tagesgeschehen heraus entwickelt.
Außerdem gehören mit über 20 Seiten Rezensionen pro Heft zu den wenigen Publikationsorten, in denen Leser noch ausführliche Besprechungen neuer Literatur, v. a. mit Bezug auf Thüringen, finden.
Und schließlich ist die Zeitschrift ein Sprungbrett für junge Autorinnen und Autoren, die sich mit Gedichten und Geschichten in der Zeitschrift erstmals oder Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit wagen. So haben u.a. Daniela Danz, Nancy Hünger und Uljana Wolf im »Palmbaum« debütiert.
Der Thüringer Literaturrat kümmert sich um die finanzielle Verwaltung der Zeitschrift. Die Chefredaktion liegt in den Händen von Dr. Jens-Fietje Dwars. Ihn unterstützt bei der Themenfindung ein Beirat, der paritätisch vom Thüringer Literaturrat e.V. und der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. besetzt wird.
Inhaltlich verknüpft der Thüringer Literaturrat Inhalte der Zeitschrift an passenden Stellen mit der Website www.literaturland-thueringen.de.
Wer Interesse an der Mitarbeit hat oder Themen vorschlagen möchte, die die Zeitschrift bearbeiten soll, kann sich gern an den Thüringer Literaturrat e.V. wenden. Wir leiten alle Anfragen gern weiter.
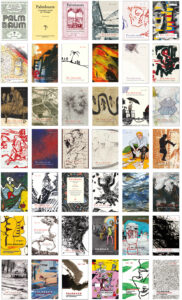
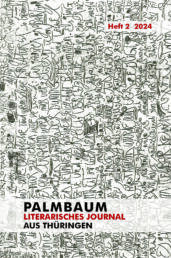
Cover mit einer Graphik von Gerd Sonntag
Heft 79
EDITORIAL
Im September 1774 erschien auf der Leipziger Buchmesse ein schmales Bändchen, anonym, mit dem Titel Die Leiden des jungen Werthers. In kürzester Zeit avancierte der Briefroman zu einem europäischen Bestseller und sein Autor, ebenso schnell als Johann Wolfgang Goethe entdeckt, zum Jungstar mit nur 25 Jahren. Man trug die Werther-Tracht: blauen Frack und gelbe Weste. Und die Alten wetterten, nun werde auch bald der Selbstmord Mode sein. Tatsächlich bestätigen heutige Studien ein knappes Dutzend solcher Suizide. Doch viel wichtiger war die literarische Wirkung des Romans, der zum Leitmodell einer ganzen Epoche wurde: der Empfindsamkeit. 225 Jahre danach nehmen wir das Jubiläum zum Anlass, um
nach vergleichbaren »Fällen« zu suchen, in denen gleichfalls frühe Werke junger Autorinnen und Autoren Zäsuren in der Literaturgeschichte gesetzt haben. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit solcher Sternstunden? Und wo bleiben die Texte junger Leute, die uns heute ebenso ergreifen, überraschen, begeistern könnten?
Wir fragen, was uns Werther heute noch sagt, erinnern an Büchner (U. Kaufmann), Rimbaud (Chr. Schmitz-Scholemann), Thomas Mann (K. Bellin), der mit 21 die Buddenbrooks konzipierte, an die Debüts von Peter Handke (H.-D. Schütt) und Elfriede Jelinek (K. Decker), an die Reihe Außer der Reihe (A. Wünsche) und den Streit um Axolotl Roadkill von Helene Hegemann (R. Nikolić). Der Lyrikblock umfasst diesmal fast 30 Seiten mit Gedichten u.a. von Johannes Witek, Mayjia Gille, Wilhelm Bartsch und Peter Gosse. Unter Prosa bringen wir u.a. Alltagsbeobachtungen von Andrea Richter sowie experimentelle Texte von Olaf Trunschke
und Mandy Susann Buchholz. Im Essay-Block liest Tobias Bulang das Gedicht Schlachtfeld von Wulf Kirsten im Licht heutiger Kriege, reflektiert der Bildhauer Walter Sachs über die Entstehung seiner Pygmalion-Figur und sehen wir kritisch auf neue Goethe- und Nietzsche-Ausstellungen in Jena und Naumburg. Wir dokumentieren die Weimarer Lyriknacht mit
Gedichten von Martin Piekar, Linn Penelope Rieger, Tina Neumann und Angela Krauß. Auf literarische Spurensuche geht André Schinkel, der die Lebensstationen Klopstocks beschreibt – eines Senkrechtstarters vor Goethe. Und schließlich bringen wir über 20 Seiten Literaturempfehlungen und stellen mit dem Einband-Grafiker Gerd Sonntag einen Maler vor, der vor 70 Jahren in Weimar geboren wurde und heute mit Glas Skulpturen erschafft, die weltweit bestaunt, bewundert und gesammelt werden.
Jens‑F. Dwars
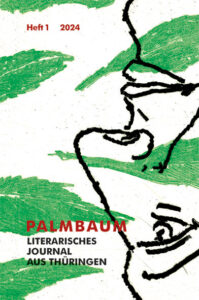
Cover mit einer Graphik von Sighard Gille
Heft 78
EDITORIAL
Die Thüringer Residenzlandschaft soll Weltkulturerbe werden. Dafür gibt es gute Gründe: Die Dichte an Residenzstädten ist enorm, und jeder dieser Höfe besaß nicht nur Schlösser und Gärten, sondern auch Kunstsammlungen und Orchester, förderte Maler und Dichter. Freilich ist die Quantität nicht automatisch ein Garant für Qualität. Wir fragen daher, was es da zu erben gibt.
Astrid Ackermann und Claudia Schönfeld begründen den UNESCO- Welterbeantrag. Eine Übersicht lässt die verwickelte Teilungsgeschichte der Thüringer Klein- und Kleinsstaaten nachvollziehen. Detlef Ignasiak skizziert die Spezifik der hiesigen Hofkultur im 17. Jahrhundert, als der Herrschaftsauftrag noch als protestantische Friedensmission verstanden wurde. Achim Wünsche zeigt am Exempel des Weißenfelser Herzoghofes, wie der Zwang zur Präsentation im Barock auch zu zwanghafter Prunksucht verkommen konnte. Ingo Pfeifer berichtet von Dessau-Wörlitz als dem Vorbild Weimars, während Klaus Bellin daran erinnert, dass Wielands Werk jenseits des vermeintlichen Musenhofes entstand. Beate Hölscher porträtiert die Hofdame Luise von Göchhausen, die uns wiederum zum „Hofdichter“ Goethe führt, der Maskenzüge für Tanzabende lieferte. Gerhard R. Kaiser zeigt, wie in Werken Jean Pauls Enge der Kleinstaaterei und Weite des Blicks zu einem seltsamen Stil verschmolzen, der ihn zum Lieblingsdichter der Deutschen machte. Rolf Schneider erinnert an den Theaterherzog von Meiningen und Anne Viola Siebert spürt der Spezifik des Kunstsammlers Bernhard von Lindenau in Altenburg nach.
Wir präsentieren einen Vorabdruck aus dem neuen Gedichtband von Lutz Rathenow, daneben Lyrik von Thomas Böhme, Peter Gosse, Joachim Werneburg u.a. Unter Prosa bringen wir einen Auszug aus einem Buchprojekt von Landolf Scherzer über die „kleinen Leute“, eine Kurzgeschichte von Ronny Thon und eine Miszelle von B.K. Tragelehn.
Dietmar Ebert befragt Günter Schmidt nach seinem Buch über die Jenaer Zensur-Geschichte. Der Essay-Block umfasst 40 Seiten, u.a. zu Kant und seinem Echo in Jena, Beaumarchais und Volker Braun. Nancy Hünger schließlich fragt, in was für Zeiten wir leben.
Wir folgen den Spuren von Bonifatius, laden zur Wiederentdeckung Oscar Wolffs ein und erinnern an Kafkas unglückliche Liebe in Weimar 1912. Wie immer empfehlen wir Ihnen neue Bücher und stellen den Einband-Grafiker vor: diesmal den Leipziger Maler Sighard Gille.
Jens‑F. Dwars
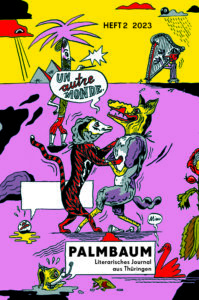
Cover mit einer Zeichnung von Jakob Hinrichs
Heft 77
EDITORIAL
Comics sind »zu räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen vermitteln und/oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen.« So definiert sie Scott McCloud in seinem Klassiker Comics richtig lesen (1994). Wir reden lieber von Bilder-Geschichten und versuchen, ihren ungeheuren Erfolg zu ergründen. Sind diese Mischformen aus Text und Bild Literatur für Analphabeten, Bilderbücher für Erwachsene, die zu faul zum Lesen sind – oder eine neue, zeitgemäße Kunstform? Comic-Bücher, ‑Verlage und ‑Buchhandlungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Längst sind es keine Billig-Heftchen mehr, die der Bildungsbürger einst als Schund abgetan hat. Zumal in der Gestalt der Graphic Novel (lesen Sie Till Schröder) erobern die Geschichtenzeichner die Weltliteratur, werden zu Buchkünstlern, Vermittlern von Bildung. Wir laden dazu ein, diese neue Literaturgattung ernst zu nehmen, sichten ihre Vorformen in der Geschichte (u.a. Lutz Rathenow über den Struwwelpeter und Hansjörg Rothe über Batman) und lassen Künstler zu Wort kommen, die sich zur Lust am Comic bekennen: Moritz Götze verbeugt sich vor Hannes Hegen und von Gerd Mackensen, dem Thüringer Malersouverän, den ein Herzinfarkt im Sommer mitten aus seinem Schaffen gerissen hat, bringen wir die berührende Skizze zu einem »Abschied« als Comic.
Wir dokumentieren die Weimarer Lyrik-Nacht und bringen im Prosa-Block eine Erzählung von Kathrin Schmidt, Schauspieler-Porträts von Hans-Dieter Schütt, feine Miniaturen von Wolfgang Haak und den Bericht von Verena Paul-Zinserling über Erinnerungen an Christa Wolf in ihrer heute polnischen Geburtsstadt. Unter Essay finden Sie u.a. Beiträge zu Nietzsche (Jürgen Große), Habermas (Günter Schmidt), Reiner Kunze (Dietmar Jacobsen) und zur Zensur in der DDR (Jürgen Engler).
Unsere Spurensuche blickt auf den Götz, mit dem Goethe vor 250 Jahren die Bühne betrat. Volker Wahl präsentiert neue Archivfunde zum jungen Gerhart Hauptmann in Jena und Weimar. Und Katrin Lemke sichtet das umstrittene Werk von Lulu von Strauß und Torney zu deren 150. Geburtstag. Prall gefüllt mit Leseanregungen sind die Rezensionen und als Finale bringen wir die Dankrede von Daniela Danz zum Thüringer Literaturpreis. Den Einband hat Jakob Hinrichs gezeichnet, der »normalerweise« für die New York Times, den Guardian und andere Blätter der Welt arbeitet. Übrigens können Sie noch bis zum 5. November alle vorhergehenden Einbände zum 30. Geburtstag des Palmbaums im Jenaer Romantikerhaus sehen.
Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Zeichnung von Dieter Goltzsche
Heft 76
EDITORIAL
Das Herbstheft 2022 hat schon einmal versucht, der Zeit den Spiegel vorzuhalten: die absurde Welt zum Tanzen zu bringen, indem sie ihr die eigene Melodie vorspielt. Wir erinnerten an das Treffen der Dadaisten und Konstruktivisten im September 1922 in Weimar. Natürlich waren unsere Nadelstiche so wirkungslos wie die unserer Vorgänger. Schlimmer noch: hatte man Schwitters & Co. im Jenaer Kunstverein wenigstens noch ausgebuht, stieß unserer Dada-Abend im Romantikerhaus nur noch auf allgemeinen Beifall und fröhlich lachende Gesichter. Dabei hatte ich das Aussichtslose unseres Bemühens schon im Editorial vorweggenommen: Wir haben uns im Absurden eingerichtet, die Verhältnisse absurd zu nennen, ist keine Provokation mehr.
Nun greifen wir ins finstere Herz dieser Wirklichkeit und fragen sie, die sich so reich gibt wie keine Zeit vor ihr, was das denn ist: Reichtum? Der Kontostand auf der Bank? Geschenkt: die solcherart Reichen sind arm dran, weil permanent auf der Jagd nach neuen Anlagemöglichkeiten. Noch sind wir weit von der Inflation vor hundert Jahren entfernt, aber schon ist die Entwertung des Geldes rasant spürbar. Nur des Geldes? Was sind denn wahre Werte? Was ist ein reiches Leben? Und was verrät uns Literatur über solche Fragen? Fast alle Märchen kreisen um Haben oder Sein: Wer Reichtum für Besitz hält, verliert alles, während jene, die „reinen Herzens“ sind, als das kenntlich werden, was sie schon immer waren: reich in sich, in ihrer Art zu sein. Und deshalb wird der Verzicht auf äußeren Reichtum, bei Franz von Assisi, zum Zeichen für den inneren. Aber das Innere gibt auch Rätsel auf: wieso war ein so reicher Geist wie Goethe so arm im Herzen, dass er seinem Sohn nicht zu geben vermochte, worum der ihn bat: die Liebe eines Vaters? Was ist immaterieller Reichtum der Kultur, wie kann die UNESCO ihn bewahren? Und worin besteht der Reichtum unserer Sprache? Wird künstliche Intelligenz ihn erweitern?
Unser Lyrik-Block umfasst 20 Seiten. Unter Prosa bringen wir u.a. autobiografische Erzählungen von Wulf Kirsten. Der Spracharbeiter ist im Dezember von uns gegangen. Ein großer Verlust nicht nur für die Thüringer Literatur. Im Essay-Block versuchen wir eine doppelte Annäherung an Günter Grass: an seine Lebensspuren und eine Nachlass-Erzählung über die Naumburger Uta. Friedrich Dieckmann schließlich rechnet mit dem verkürzten Denken der Gegenwart ab. Lassen Sie sich von 20 Seiten Rezensionen anregen und feiern Sie mit uns 30 Jahre Palmbaum: in einer Ausstellung auf Schloß Burgk bis zum 25. Juni.
Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Collage von Reinhard Zabka
Heft 75
EDITORIAL
Alles Dada? Die absurde Welt und die Welt des Absurden
Die Welt ist absurd, das allzu kurze Gedächtnis der Menschheit der verlässlichste Humus, auf dem die dreistesten Lügen gedeihen: Die Supermacht, die so viele Kriege wider das Völkerrecht geführt, Régime unterwandert und gestürzt hat wie keine andere im 20. Jahrhundert, erscheint als Friedensengel, der die Welt Moral lehrt. Der »Westen«, das Imperium des Kapitals, das von der Pariser Commune über die Interventionsfeldzüge gegen das junge Sowjetrussland bis zu Allendes Unidat Popular noch jede Erhebung der Besitzlosen in ihrem eigenen Blut zu ersticken versucht hat, erklärt sich zum alleinigen Verteidiger von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Eine alte Dame, die 70 Jahre lang nichts anderes zu tun hatte, als die Auflösung des einst größten Kolonialreichs der Erde mit anachronistischen Ritualen freundlich lächelnd zu begleiten, wird als Dienerin ihres Volkes mit dem größten Pomp aller Zeiten zu Grabe getragen. Und eine wahre Hoffnungsgestalt, die vormals zu Abrüstung und »Neuem Denken« ermutigt hatte, wird von jenen mit Krokodilstränen betrauert, die ihr Leben lang alles dafür taten, dass sich seine Vision einer sozial gerechteren Welt nicht erfüllt. Während ein Nachfolger dieses »Helden des Rückzugs« (Enzensberger) die Zukunft in der Vergangenheit sucht: in der Zarenherrschaft eines östlichen Imperiums.
Das Absurde ist, abgeleitet vom lateinischen »absurditas«, das »Misstönende«, das »Ungereimte«, das Wider- und Unsinnige. Solange der Aberwitz die Ausnahme von der Regel ist, kann man ihn verlachen. Wie überhaupt der Witz seit Urzeiten die schärfste Waffe der Unterlegenen war. Der Witz als Geheimwaffe: bei Monty Python warf man ihn über die Frontlinien, damit der Feind sich totlache. Doch was tun, wenn der Irrwitz zur Normalität wird. Wenn das Massenschlachten weiter- und weiter geht und wir sehenden Auges in den Abgrund rasen?
1916, mitten im ersten großen Weltgemetzel, brachte Hugo Ball das Offenkundige im Club Voltaire zur Sprache: »jolifanto bambla ô falli bambla«. Wenn die zivilisiertesten Nationen Europas einander mit wehenden Fahnen an die Gurgel gehen, dann sind sie dada. Dabei hatten sich noch 1912 Vertreter aller Arbeiterparteien im Münster von Basel hoch und heilig geschworen, die Waffen wider die Herren im eigenen Lande zu kehren, wenn die einen Weltkrieg entfachen und die Völker gegen einander aufhetzen würden. Doch nur ein gewisser Wladimir Uljanow hielt sich an die Abmachung, der 1916 wie die Dadaisten in der Zürcher Spiegelgasse hauste und dem Augenblick der Entscheidung entgegenfieberte.
Peter Weiss verdichtet dieses Zugleich in seiner Ästhetik des Widerstands zum Bild der »doppelten Revolution«, des politischen Aufbruchs und der Entfesselung der Phantasie. Doch belegen die Realereignisse und die daraus folgende Geschichte nur das Nebeneinander der beiden Revolutionen, aus dem ein Gegeneinader zu beider Schaden erwuchs. Die siegreiche Politik erstarrte zum phantasielosen Machtapparat und die Kunst-Avantgarde zum Spekulationsobjekt für Sammler und Fetisch der Museen. Wäre die Geschichte des 20. Jahrhunderts anders verlaufen, wenn das soziale Aufbegehren sich mit den Form-Experimenten der Künstler verbunden hätte?
Oder ist das Schnee von Gestern, holt uns das Vorgestern ein: das Bewusstsein, dass die Welt schon immer absurd war und das Absurde in den Künsten ein Training, um mit den Widrigkeiten des Daseins fertig zu werden? Wie die Baumeister des Mittelalters, die mit Teufelsfratzen und Monstren als Wasserspeier einst die bösen Geister zu bannen suchten. War das Relief der »Schachspielenden Affen« im Naumburger Dom eine Warnung an die Kleriker, sich nicht dem Spiel hinzugeben, das die Kirche verboten hatte? Oder ein Bild dafür, dass der Mensch auch in der Klugheit nicht aufhört, ein Tier zu sein? Wie es bei Goethe später heißt: »Er nennt‘s Vernunft und braucht‘s allein, / Nur tierischer als jedes Tier zu sein.«
Nicht im Tier lauert das Monster, sondern im Menschen, der maßlos Maßloses begehrend alle Grenzen der Natur missachtet. Je strahlender, desto schrecklicher: wie Phöbus, der Sonnengleiche, in Hugos Der Glöckner von Notre Dame. Das Monströse ist das Unförmige, das verlacht und gefürchtet wird, wie Quasimodo, der Verkannte. Kay Voigtmann, ein heutiger Maler, zeichnet kleine bissige Monster mit überaus scharfen Zähnen, die gerade in ihrer Unvollkommenheit menschlich erscheinen: »Alles Formvollendete hat für mich etwas Fern-Unwirkliches und Unmenschliches«, bekennt er, »alles Ideale etwas Endgültiges, etwas, was also nüscht mehr transportiert und was es so hinieden nicht geben kann …« Ist das absurd – oder weise?
In jedem Kind keimt eine neue Welt, wird die Sprache neu geboren mit jedem lustvollen »da dada dada da …«
Jens‑F. Dwars
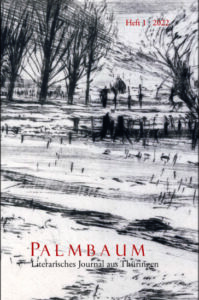
Cover mit einer Graphik von Susanne Theumer
Heft 74
EDITORIAL
Was ist romantisch?
Er galt 150 Jahr lang als das Idealbild des Dichters: Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte. Heute scheint er dem Zeitgeist fremd geworden zu sein. Der 250. Geburtstag von Goethe war 1999 ein Ereignis, der 250. von Schiller rief 2009 noch ein starkes Echo hervor, auch wenn sich viele Verlage bereits zu seinem 200. Todestag vier Jahre zuvor verausgabt hatten. Zu Hölderlins und Hegels 250. erschienen unlängst wenigstens ein paar Bücher – der Inbegriff des Jugenddichters aber scheint heute niemanden mehr zu interessieren, obwohl sich das Novalis-Bild in den vergangenen 30, 40 Jahren grundlegend gewandelt hat: der vermeintlich weltabgewandte Romantiker gehörte zu den tatkräftigsten Dichtern und Denkern seiner Zeit. Entdecken Sie diesen Fremdkörper!
Detlef Ignasiak verfolgt seine Spuren in Thüringen, Ingmar Werneburg widmet sich dem Naturphilosophen Novalis und André Schinkel spürt dem Dichter nach, der die Poesie im Nächtigen, im Traum, an der Grenze zwischen Innen und Außen, Leben und Tod verankert. Lesen Sie den Ofterdingen als Duell mit Goethes Wilhelm Meister und erfahren Sie von Gunnar Decker, wie in der Literatur der DDR um Romantik gerungen wurde. Wilhelm Bartsch erinnert an die Novalis-Trilogie von Gisela Kraft und Jörg Kowalski berichtet von der Rettung des Novalis-Geburtshauses Schloss Oberwiederstedt. Und wie nahe uns Novalis kommen kann, das zeigen Fragmente aus einem Tagebuch der Trauer von Olga Martynova.
Gedichte bringen wir von Volker Braun, Eberhard Häfner, Michael Spyra, Johannes Witek, Holger Brülls, Thomas Rackwitz, Wolfgang Haak und Joachim Werneburg. Neue Prosa von André Schinkel, Kathrin Groß-Striffler, Anke Engelmann und Frank Quilitzsch. Im Essay-Block verdeutlicht Leopold Federmair die Schwierigkeiten, Wulf Kirsten ins Französische zu übersetzen – wofür Stéphane Michaud soeben ausgezeichnet wurde. Weitere Beiträge widmen sich u.a. der Tradition im Lyrischen und der Frage nach dem immatriellen Erbe. Unter »Literarischer Spurensuche« erinnern wir an die Thüringer Wurzeln des Christoffel von Grimmelshausen, den »kalten Witzling« Friedrich Schlegel, die Cospedaer Jugendjahre des Friedrich Justin Bertuch und an den 100. Geburtstag von Walter Werner. Wir fragen in Interviews, wie es mit dem Jenaer Romantikerhaus weitergeht und welche Erfahrungen Lutz Rathenow in seinem politischen Amt gemacht hat: war es Last oder Lust?
Fast 25 Seiten umfassen unsere Rezensionen und im Gespräch mit der Einbandgestalterin stellen wir eine Frau vor, die das Grau des Lebens, die Randbezirke und Zwischenräume der Unentschiedenheit, die uns oft verzweifeln lassen – mit ihrer Kunst zum Leuchten bringt: Susanne Theumer.
Jens‑F. Dwars
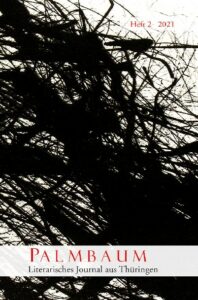
Cover mit einer Graphik von Max Uhlig
Heft 73
EDITORIAL
Alle reden von Klima‑, Umwelt- und Naturschutz. Aber was ist Natur? Alles, was rings um uns wächst und gedeiht, das Lebendige? Oder jegliche Materie? Die Erde, das All? Welch Hybris, das alles retten zu wollen. Und was vermag Literatur dabei, was Dichtung?
Diesen Fragen geht unser Titelthema nach. Kerstin Decker erinnert an Rousseaus Weckruf »Zurück zur Natur!«, mit Seume betrachten wir die Denkfigur des »Edlen Wilden«, Heidrun Jänchen folgt dem Natur-Motiv in der Science Fiction und Jürgen Engler beobachtet exemplarisch, wie Natur bei Arno Holz und Franz Josef Czernin buchstäblich zu Wort kommt. Von Richard Pietraß bringen wir eine Poetikvorlesung zur Natur in der deutschen Lyrik, Dietmar Jacobsen interpretiert ein Gedicht von Wulf Kirsten und Nancy Hünger warnt eindringlich vor der absurden Hoffnung, die Menschheit könne sich vor den Folgen ihres Tuns auf den Mars retten …
Neue Lyrik bringen wir von Wulf Kirsten, Annerose Kirchner, Wilhelm Bartsch, Friederike Haerter und Lutz Rathenow. Neue Prosa von Katrin Lemke und Jens Grandt. Im Essay-Block denkt Hansjörg Rothe über den »Romantiker« Dean Reed nach und gedenkt Klaus Bellin des 50. Todestages von Walther Victor, der einst mit »Lesebüchern für unsere Zeit« das klassische Erbe für Leser seiner Gegenwart erschließen wollte.
Zusammengestellt von Ron Winkler gratuliert ein Brevier mit gleich 14 Autorinnen und Autoren Eberhard Häfner zum 80. Geburtstag, einem der eigenwilligsten Lyriker unserer Tage, der 1941 im Thüringischen Steinbach-Hallenberg geboren wurde. Wir besprechen auf 30 Seiten jüngste Literatur und erstveröffentlichen Laudatio und Dankesrede zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Steffen Mensching.
In einem Porträt stellen wir zudem den Einband-Grafiker vor: Der Dresdner Maler Max Uhlig gehört zu den profiliertesten Künstlern aus dem Osten Deutschlands. Früh fand er zu einer eigenständigen Bildsprache, die auch dem vorliegenden Palmbaum-Heft einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Wer sich unter »Natur« eine idyllische Landschaft vorstellt, den wird die Radierung Bewegte Baumkrone schockieren: roh, rau, widerborstig wirkt sie auf den ersten Blick eher abstoßend, aber dann, länger betrachtet, lädt sie dazu ein, genauer hinzusehen, sich in das Geflecht der Linien hineinzubegeben, die Kraft des Baumes zu spüren, dessen Krone der Wind peitscht und der ihm dennoch widersteht. Das ist Natur!
Jens‑F. Dwars
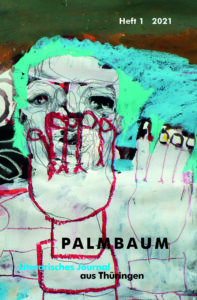
Cover mit einer Zeichnung von Rüdiger Giebler (Halle/Saale)
Heft 72
EDITORIAL
Zensur? Das ist doch Schnee von gestern! Tatsächlich: die plumpe Zensur von Kirchen und Staaten, die unliebsame Bücher auf Verbotslisten stellten, durch »Druckgenehmigungs-verfahren« und mit vermeintlich wissenschaftlichen Gutachten in die Produktion eingriffen oder mittels Papierbeschränkungen die Auflagen knebelten, das alles ist in den meisten Ländern der Erde eine halb schon vergessene Geschichte. Auch deshalb lohnt es sich, an diese Geschichte(n) zu erinnern, mithin auch nach den Argumenten der Zensoren zu fragen, deren einer – Goethe war.
Und leben wir denn heute in gänzlich zensurfreien Zeiten? Manche behaupten, man dürfe »die Wahrheit« heute nicht mehr sagen, »Political Correctness« sei die neue Zensur, die uns zwinge, von Meinungshütern vorgegebene Worthülsen einzuhalten, um nicht an den Pranger gestellt zu werden. Da ist gewiss viel – kalkulierte – Übertreibung am Werk und oft sind die Anprangerer des Prangers selbst die größten Hexenjäger, die in der Anonymität des Internets Hass und Häme schüren. Dennoch bleibt es ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit, dass die Freiheit, sich öffentlich zu äußern, noch nie so groß war, und die Chance, damit etwas zu ändern, noch nie so gering. Vielleicht haben übereifrige Sprachregelungen bis hin zur Gender-Akkuratesse genau damit zu tun: wenigstens in der Wortwahl will man auf der Seite der Sieger stehn, wenn man schon sonst nichts zu wählen hat. Unfreiwillig komisch ist die Zensur an Goethes Erotica, wie man ihr mit Witz begegnen konnte zeigen Cover des Malik-Verlages, aber auch Texte von Wulf Kirsten und Lutz Rathenow.
Neue Lyrik bringen wir u.a. von Andreas Reimann und Thomas Böhme. Eine späte Entdeckung sind Nachlassgedichte von Herbert Sailer. Wie verschieden man über das sprechen kann, was gemeinhin »Liebe« genannt wird, demonstriert der Prosa-Block.
In einem ausführlichen Interview (13 Seiten!) gibt Sigrid Damm über ihr jüngstes Buch Auskunft, das von der durchaus widersprüchlichen Beziehung zwischen Goethe und »seinem« Herzog Carl August erzählt.
Unter »Literarischer Spurensuche« erinnern wir an Rahel Varnhagen und den Barockdichter Georg Neumark. Die wunderbar wilde Einbandzeichnung stammt von dem Hallenser Maler Rüdiger Giebler, der gemeinsam mit seinem Freund Moritz Götze die Nietzsche-Kirche in Pobles retten will. Eine verrückte Idee? Nein: eine lebendige! Die schönste Osterbotschaft: Der Geist von Kaisersaschern lebt …
Jens‑F. Dwars
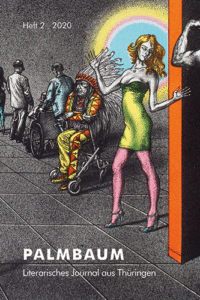
Cover mit einer Lithografie von Uwe Pfeifer (Halle)
Heft 71
EDITORIAL
Das Wort »Heimat«, oft idyllisch verklärt, ist zum Kampfbegriff geworden, zum Joker im Wahlrummel der Parteien. Deshalb widmen wir ihm ein Heft und stellen ein Fragezeichen dahinter. Was ist Heimat? Was war sie, könnte sie sein? Und welche Rolle spielt sie in der Literatur – einst und heute?
Bloch nannte Heimat »etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war«. Gunnar Decker folgt dieser Denkspur und erkundet die Notwendigkeit der Utopie für jegliches Zusammenleben. Klaus Bellin liest Hölderlins Vaterländischen Gesänge gegen den Strich ihrer national-konservativen Vereinahmung. Katrin Lemke nimmt den »Heimatdichter« Hermann Löns auseinander. Matthias Biskupek berichtet davon, wie die Hymne der Thüringer entstand: ihr Rennsteiglied. Róža Domašcyna erinnert an ein DDR-Kinderlied, während Stefan Petermann und Annerose Kirchner das Heimatgefühl in den kleinsten Dörfern des Freistaates erkunden und Christoph Schmitz-Scholemann sich selbst befragt, inwieweit in den vergangenen 30 Jahren im erweiterten Deutschland zusammen gewachsen ist, was zusammen gehört. Ulf Annel nimmt sich des Themas kabarettistisch an und Ralph Grüneberger sagt mit einem Gedicht, was sein Zuhause ausmacht. Asal Dardan schließlich wendet den Blick ins Globale: im Iran geboren, fragt sie im Exil, wo ihre Heimat sei. Ihr Text wurde mit dem Caroline-Preis für Essayistik ausgezeichnet.
Im Lyrik-Block finden Sie u.a. Pandemische Elegien von Matthias Biskupek und eine Ode von Joachim Werneburg in Hölderlinschem Versmaß. Prosa bringen wir von Friedbert Jost, Hans Lucke und Nancy Hünger. Unter Essay erscheint die Einleitung zu einem Buch von Edelbert Richter. Das einstige Mitglied des Bundestages stellt unbequeme Fragen nach positiven Traditionen, auf die sich das vereinte Deutschland heute besinnen könnte. Jürgen Große dagegen hat ein Buch über die Sprachdifferenzen in Ost und West geschrieben. Und ein faksimilierter Brief von Gottfried Benn ermutigt alle Schreibenden in Corona-Zeiten: sich aufs Schreiben zu besinnen!
Unter »Literarischer Spurensuche« bringen wir einen Philosophen-Block: mit Beiträgen über Hölderlin, Hegel, Fichte und Forberg.
Für den Einband haben wir eine Lithografie von Uwe Pfeifer verwandt, dem Hallenser Maler, der seit 40 Jahren Sachlichkeit mit Traumvisionen vermählt. Und unsere Rezensionen umfassen diesmal über 30 Seiten. Weihnachten naht, verschenken Sie Bücher, die Heimat aller Lesenden.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Auf der Suche nach Utopia – das literarische Bauhaus
- Beiträge von Michael Siebenbrodt (Sprache am Bauhaus), Frank Simon-Ritz (Bauhaus-Bibliothek), Micky Remann (Scheerbart und Bruno Taut), Jens‑F. Dwars (Vom gotischen Bauhaus zur funktionalen Botschaft), Patrick Rössler (Moholy Nagy und diem moderne Illustrierte), Matthias Biskupek (Verteibung durch den Geist von Weimar), Frieder W. Bergner (Hörbuch), Ulrich Kaufmann (Franziska Linkerhand), Harald Heydrich (Bauhaus in Film und Roman), Nancy Hünger (Mein Bauhaus), Olaf Weber (Transkription des Bauhauses in ein Museum)
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Hans Ticha).
- PROSA von Hans Richter, Elisabeth Dommer, Gorch Maltzen.
- LYRIK von Ingo Cesaro, Holger Brülls, Annerose Kirchner, Detlef Färber, Thomas rackwitz, Lutz Rathenow, Joachim Werneburg.
- Essays mit Hans-Dieter Schütt (Für Wulf Kirsten), Wilhelm Bartsch (Hilbig trifft Novalis).
- SPURENSUCHE von Ingmar Werneburg (Ernst Haeckel und Goethe), Dertlef Ignasiak (Mascha Kaléko).
- EHRUNG für Albrecht Börner (Ignasiak), Nachruf auf Harald Wenzel-Orf (Dwars).
- REZENSIONEN

Cover mit einer Algrafie von Angela Hampel (Dresden)
Heft 70
EDITORIAL
Der Geburtstag von Sophie Mereau (1770–1806), die in Altenburg zur Welt kam und im Umkreis der Jenaer Frühromantiker Gedichte und Romane verfasst hat, jährt sich am 27. März zum 250. Male. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, um in Geschichte und Gegenwart zu erkunden, ob Frauen anders als Männer schreiben.
»Weibliches Schreiben« war einmal ein Kampffeld, auf dem um Deutungshoheit gerungen wurde, ein Fahnenwort der Emanzipationsbewegungen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Heute scheint das Thema kaum noch eine Rolle zu spielen, trotz Me-too-Rummel in den Massenmedien. Geschlechterdebatten werden nur noch um »gender-gerechte« Anreden geführt, die Frage, inwieweit das Geschlecht das Schreiben selber prägt, welches Potential darin steckt, taucht kaum noch auf. Wir haben daher Autorinnen und Autoren gebeten, über das Thema nachzudenken. Unter anderem erinnern Christoph Schmitz-Scholemann an die legendäre Sappho und Verena Paul-Zinserling an eine gekränte Poetin aus Erfurt (Sidonia Zäunemann), Ulrike Müller bedenkt die Versuche von Caroline Schlegel und Charlotte von Stein, sich mit Ironie männlicher Normsetzungen zu erwehren, Kerstin Decker berichtet über die Schreiberfahrungen von Lou von Salomé bei Nietzsche, Katrin Lemke zeigt, wie zweifelhaft das Lob der Männer (gegenüber Helene Voigt-Diederichs) sein kann, Wilhelm Bartsch erzählt von seinen Zauberlehrjahren bei Sarah Kirsch, Kathrin Schmidt erinnert an Christa Wolf und Christine Hansmann an Gisela Kraft. Wortmeldungen zum »weiblichen Schreiben« (u.a. von Róža Domašcyna) führen ins Hier und Heute. Neue Lyrik bringen wir u.a. von Christa Cibulka, Ingo Cesaro und Michael Hillen. Neue Prosa von Kathrin Groß-Striffler und Rainer Wedler. Besonders stark ist der Essay-Block mit Texten von Friedrich Dieckmann, Rolf Schneider, Ulrich Kaufmann und der letzten Goethe-Studie Bernd Leistners. Und mit Detlef Ignasiak sprechen wir über seinen 1000-seitigen Literaturführer durch Thüringen, der nach 20 Jahren Arbeit zu Ostern erscheint.
Unter »Literarischer Spurensuche« gedenken wir des 250. Geburtstages von Hölderlin, der vor 225 Jahren daran gescheitert ist, in Jena Fuß zu fassen. Wir bringen eine Kritik der Hölderlin-Biografie von Safranski und die Adaption eines Hölderlin-Motivs von Roland Bärwinkel.
Für den Einband konnten wir Angela Hampel gewinnen. Lesen Sie das Interview mit der Dresdnerin, die seit 1985 wehrhaft stolze Frauen zeichnet, also auf Papier und Leinwand »weibliches Schreiben« auf andere Art praktiziert.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Weibliches Schreiben
- Beiträge von Christoph Schmitz-Scholemann (Sappho), Verena Paul-Zinserling (Sidonia H. Zäunemann), Annette Seemann (Sophie Mereau), Ulrike Müller (Charlotte von Steon und Caroline Schlegel-Schelling), Kerstin Decker (Lou von Salomé), Katrin Lemke (Helene Voigt-Diederichs), Harald Heydrich (Nelly Sachs), Wilhelm Bartsch (Sarah Kirsch), Kathrin Schmidt (Christa Wolf), Christine Hansmann (Gisela Kraft), Matthias Biskupek (Unbekannte Klassike-rinnen), Wortmeldungen von Annerose Kirchner, Stefan Petermann, und Róža Domašcyna.
- PALMBAUM-UMSCHLAG
(Gespräch mit Angela Hampel). - PROSA von Kathrin Groß-Striffler, Rainer Wedler, Wolfgang Wurm und Holger Brülls
- LYRIK von Christa Cibulka, Ingo Cesaro, Annerose Kirchner, Michael Spyra, Michael Hillen und Christine Hansmann
- ESSAYS von Friedrich Dieckmann (Luther und Beethoven), Bernd Leistner (Goethes Aussöhnungsvolten), Ulrich Kaufmann (Fürnberg), Rolf Schneider (Vom (Un-)Wert der Bücher), Jens‑F. Dwars (Goethes Anti-Dilettantism) und Wilhelm Bartsch (Yana Milev)
- SPURENSUCHE zu Hölderlin:
Detlef Ignasiak (H. in Thüringen), Dwars (H‑Biografie von Safranski), Roland Bärwinkel (Flagge zeigen)
- INTERVIEW mit Detlef Ignasiak zu seinem 1000-seitigen Literatur-führer durch Thüringen
- REZENSIONEN
- Nachrichten
u.a. Programm Schloss Ettersburg

Cover mit einem Kupferstich von Baldwin Zettl (Freiberg) zu dem Gedicht »Das Eigentum« von Volker Braun
Heft 69
EDITORIAL
Wir hatten gehofft, mit dem Bauhaus-Heft den »Schmerzpunkt unserer fröhlichen Gegenwart« wenigstens zu kitzeln. Viele sprachen uns privat auf das Heft an, das ja den einzigen weißen Fleck auf dem viel beackerten Feld der Weimarer Avantgarde-Schule in Augenschein nahm: den Umgang des Bauhauses mit Sprache und Literatur. Aber nirgends ein öffentliches Echo, geschweige denn eine Debatte. Nicht einmal das neue Bauhaus-Museum, das von nahezu allen großen Zeitungen Deutschlands mit Kritik bedacht wird, kann in Thüringen einen wirklichen Streit auslösen. Macht die sanfte Hügellandschaft ringsum uns so handzahm …?
So wollen wir diesmal den Blick über Thüringen hinaus richten: wir nehmen den 200. »Geburtstag« von Goethes ›West-östlichem Divan‹ zum Anlass, um nach der wechselseitigen Bereicherung von Ost und West durch Literatur zu fragen. Wir zeigen, wie deutsche Autoren seit Jahrhunderten durch Erkundung des »Ostens« das »westliche« Bewusstsein erweitert haben und unterlaufen damit einen »Ost-West-Gegensatz«, der noch immer oder schon wieder von den Vor- und Verstellungen des Kalten Krieges geprägt ist, einen Denkhorizont, für den – 30 Jahre nach der »Wiedervereinigung« – die »neuen Bundesländer« der Osten sind und Moskau schon zu Asien gehört. Mithin möchten wir an die historisch gewachsene Aufgabe Deutschlands erinnern, ein Mittler zwischen West und Ost zu sein.
Klaus Bellin skizziert die Entstehung des Goetheschen Divans. Mit Hansjörg Rothe blicken wir auf die Antike-Rezeption im Mittelalter, Sylvia Bräsel verweist auf Spuren des Konfuzianismus in der Aufklärung, Gerhard Schaumann geht dem Motiv der »russischen Seele« in der deutschen Literatur nach und Gunnar Decker befragt Hermann Hesses Indien-Bild. Harald Heydrich erinnert an Johannes Bobrowskis Sarmatischen Divan und Friedrich Schorlemmer berichtet, wie sowjetische Filme und Bücher die DDR-Opposition vor der Wende bestärkt haben. Matthias Biskupek erzählt von seinem Japan, Jürgen Große setzt sich mit Ost-Klischees am Beispiel von Ines Geipel auseinander und mit Friedrich Dieckmanns Essay über Moses bei Goethe, Schiller und Freud schließt sich der Kreis.
Natürlich bringen wir auch neue Lyrik, Prosa und Essays, gehen auf literarische Spurensuche, bringen 25 Seiten Rezensionen, Interviews mit dem Cass-Verlag und dem Kupferstecher Baldwin Zettl und als finalen Höhepunkt Laudatio und Dankesrede zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Sibylle Berg.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Ex Oriente Lux. Ein west-östlicher Divan
- Beiträge von Klaus Bellin (Goethes Divan), Hansjörg Rothe (Antigone bei Wolfram von Eschenbach), Sylvia Bräsel (Konfuzius in der Aufklärung), Gerhard Schaumann (Die »russische Seele«), Gunnar Decker (Hermann Hesses Indien), Harald Heydrich (Bobrowskis Sarmatischer Divan), Friedrich Schorlemmer (Sowjetische Filme und Bücher vor 1989), Matthias Biskupek (Japan aus DDR-Sicht), Jürgen Große (Ost-Gezeter am Beispiel von Ines Geipel), Friedrich Dieckmann (Moses bei Goethe, Schiller und Freud), Ulrich Kaufmann (Goethe-Hafis-Denkmal)
- PALMBAUM-UMSCHLAG
(Gespräch mit Baldwin Zettl). - PROSA von Wilhelm Bartsch, Wolfgang Haak, André Schinkel
- LYRIK von Friederike Haerter, Holger Uske, Cornelius van Alsum, Ulrich Kersten, Johannes Witek und Joachim Werneburg.
- ESSAYS von Wilhelm Bartsch (Hilbig), Steffen Dietzsch (NFG-Chroniken), Jens‑F. Dwars (Bauhaus-Museum Weimar / Wulf Kirsten), Rainer Noske (Kafkas »Verwandlung«).
- SPURENSUCHE von Dertlef Ignasiak (Alexander v. Humboldt / Fontane), Dwars (Konfuzius in Poschwitz), Rotraut Greßler (Der Verleger Gustav Hempel).
- WEIMARER LYRIKNACHT mit Carolin Callies, Max Sessner, Margret Kreidl und Sebastian Unger.
- INTERVIEW von Jens Kirsten mit dem Cass-Verlag (jap. Literatur)
- REZENSIONEN (25 Seiten!)
- THÜRINGER LITERATURPREIS: Laudatio von Johanna Bohley und Danksagung von Sibylle Berg
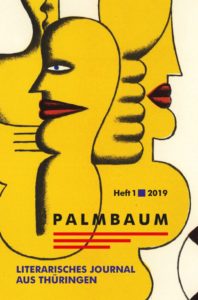
Cover mit der Lithografie »Tretboot« von Hans Ticha (Maintal)
Heft 68
EDITORIAL
Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen: Wir haben tatsächlich gehofft, mit dem Avantgarde-Heft einmal in ein Wespennest zu stoßen. Wir hoffen natürlich immer auf Ihren Widerspruch, geneigte Leserschaft. Werfen Sie uns die Hefte an den Kopf, schreien Sie uns an, machen Sie sich bemerkbar! Da haben wir nun all die heiligen Glitzerworte unserer Zeit abgeklopft: »Moderne«, »Avantgarde« – all diese Wunderkerzen auf den Sonntagstorten unserer feierwütigen Zeit. Doch gestört hat‘s keinen,nicht einmal der zornig verzweifelte Rundumschlag einer Nancy Hünger, die überall nur »Ablassliteratur« auf den Büchertischen findet, Ersatzbefriedigungen für das grassierende Unterhaltungsbedürfnis der Gebüldeten … Offenbar haben wir den Schmerzpunkt unserer fröhlichen Gegenwart noch nicht getroffen. Vielleicht gelingt es mit dem Bauhaus-Heft, das die Frage nach Möglichkeit und Grenzen von Avantgarden am konkreten Material der vor 100 Jahren in Weimar gegründeten Reformschule durchspielt. Und hier gleich das zweite Geständnis: Kein Heft war so schwer mit Inhalt zu füllen, wie dieses. Denn alles scheint über das Bauhaus gesagt und geschrieben zu sein. Also fragen wir: wie stand es um das Sagen und Schreiben am Bauhaus selbst, welche Rolle spielten Sprache und Literatur, das Wort und die Dichtkunst an einer Schule, die das Handwerk, die Grundgesetze des Bauens lehren wollte? Und wie reagierte die Dichterstadt Weimar darauf?
Dass wir über das Titelthema die anderen Rubriken nicht vernachlässigen, zeigt ein starker Lyrik-Block, der diesmal u.a. einen Sonettkranz von Thomas Rackwitz und eine »buddhistische Phantasie« von Joachim Werneburg enthält. Unter Essay bringen wir einen Gruß von Hans-Dieter Schütt an Wulf Kirsten und einen langen Aufsatz von Wilhelm Bartsch über die literarischen Tiefenbohrer Hilbig und Novalis. Ingmar Werneburg geht dem Goethe-Erbe bei Ernst Haeckel nach und Matthias Biskupek zeigt, in welche Nöte ein Autor geraten kann, wenn ein Leser ihn auf seine Worte festnagelt. Für den Palmbaum-Einband konnten wir Hans Ticha gewinnen, einen der produktivsten Erben des Bauhauses.
Übrigens greifen wir mit dem nächsten Heft ein Teilthema des vorliegenden noch einmal auf: Sah das Bauhaus in den Osten, so nehmen wir den 200. »Geburtstag« von Goethes West-östlichem Divan zum Anlass, die wechselseitige Bereicherung von West und Ost bis nach Indien und China in der Literatur zu erkunden.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Auf der Suche nach Utopia – das literarische Bauhaus
- Beiträge von Michael Siebenbrodt (Sprache am Bauhaus), Frank Simon-Ritz (Bauhaus-Bibliothek), Micky Remann (Scheerbart und Bruno Taut), Jens‑F. Dwars (Vom gotischen Bauhaus zur funktionalen Botschaft), Patrick Rössler (Moholy Nagy und diem moderne Illustrierte), Matthias Biskupek (Verteibung durch den Geist von Weimar), Frieder W. Bergner (Hörbuch), Ulrich Kaufmann (Franziska Linkerhand), Harald Heydrich (Bauhaus in Film und Roman), Nancy Hünger (Mein Bauhaus), Olaf Weber (Transkription des Bauhauses in ein Museum)
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Hans Ticha).
- PROSA von Hans Richter, Elisabeth Dommer, Gorch Maltzen.
- LYRIK von Ingo Cesaro, Holger Brülls, Annerose Kirchner, Detlef Färber, Thomas rackwitz, Lutz Rathenow, Joachim Werneburg.
- Essays mit Hans-Dieter Schütt (Für Wulf Kirsten), Wilhelm Bartsch (Hilbig trifft Novalis).
- SPURENSUCHE von Ingmar Werneburg (Ernst Haeckel und Goethe), Dertlef Ignasiak (Mascha Kaléko).
- EHRUNG für Albrecht Börner (Ignasiak), Nachruf auf Harald Wenzel-Orf (Dwars).
- REZENSIONEN

Cover mit der Collage »Am Strand der Zeiten« von Wolfgang Petrovsky (Freital)
Heft 67
EDITORIAL
Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Falsch: er ging nicht einfach vorbei, so wie er auch nicht aus heiterem Himmel ausgebrochen war. Kieler Matrosen, die sich nicht länger als Kanonenfutter verheizen lassen wollten, verweigerten das Auslaufen ihrer Schiffe, sie kehrten die Waffen um gegen die Herrschenden im eigenen Land. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um nicht zu zeigen, wie Kunst und Literatur die Novemberrevolution „dargestellt“ haben, wir fragen nach den Revolutionen in den Künsten selbst: nach den Avantgarden.
Dabei klammern wir das Bauhaus bewusst aus, da es uns im nächsten Jahr mehr als genug beschäftigen wird. Auch ins nächste Heft werden zwei Beiträge verschoben, die zur Avantgarde geplant waren: Peter Krause über „konservative Revolutionäre“ und Wilhelm Bartsch zu Wolfgang Hilbigs Dialog mit Novalis. Wir sind uns sicher, dass die vorliegenden Essays zu Hölderlin, Nietzsche, Brecht & Benjamin, zur Konkreten Poesie, zum Streit um Eislers Faustus-Oper, über eine ungewöhnliche Ubu-Inszenierung an einer DDR-Schule, zur Reihe Außer der Reihe und zum Schreiben im digitalen Zeitalter genug Stoff zum Nachdenken liefern. Friedrich Dieckmann wagt eine Antwort auf die Frage, welche Kunst wir bräuchten, und Nancy Hünger ruft zum Streit um „Ablassliteratur“ auf …
Neue Lyrik bringen wir von Anna Ribeau, Michael Hillen, Ullrich Kersten, Ron Winkler und Michael Spyra, neue Prosa von Nancy Hünger, Horst Hussel, Daniel Zahno und Ursula Schütt. Außerdem dokumentieren wir die Weimarer Lyriknacht.
Im Interview befragen wir Steffen Mensching nach seinem neuen Roman Schermanns Augen. Die Spurensuche widmet sich diesmal dem Wirken von Großherzog Carl Alexander, der von einem „Silbernen Weimar“ träumte, und Johannes Falk.
Für den Palmbaum-Einband hat uns Wolfgang Petrovsky eine im wahrsten Wortsinn fein verwobene Collage geschaffen: Fundsachen am Strand der Zeiten … Der Rezensions-Block umfasst mal wieder über 30 Seiten, Lesefutter und vielleicht auch brauchbare Vorschläge für kommende Weihnachtskäufe.
Unter der Rubrik Aus dem literarischen Leben berichten wir u.a. über die 29. Werkstatt des Südthüringer Literarturvereins und drucken eine Auswahl der entstandenen Texte. Bleiben Sie uns treu: Streiten Sie mit uns!
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Avantgarde – 100 Jahre Revolution in den Künsten
- Beiträge von Hans-Dieter Schütt (Hölderlin), Jens‑F. Dwars (Nietzsche), B.K. Tragelehn (Brecht und Benjamin), Harald Heydrich (Konkrete Poesie), Dietmar Ebert (Hanns Eisler), Ulrich Kaufmann (Ubu als Puppenspiel), Klaus Pankow (Die Reihe Außer der Reihe), Friedrich Dieckmann (Welche Kunst brauchen wir?), Stefan Petermann (Digitales Schreiben), Nancy Hünger (Nach den Avantgarden).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Wolfgang Petrovsky).
- PROSA von Nancy Hünger, Horst Hussel, Daniel Zahno und Ursula Schütt.
- LYRIK von Anna Ribeau, Michael Hillen, Ron Winkler, Ulrich Kersten und Michael Spyra.
- INTERVIEW mit Steffen Mensching.
- WEIMARER LYRINACHT mit Levin Westermann, Ulf Stolterfoht, Sibylla Vricic Hausmann und Sylvia Geist.
- SPURENSUCHE von Hans Lucke (Groß-herzog Carl Alexander) und Dietlind Steinhöfel (Johannes Falk)
- EHRUNGEN für Reiner Kunze (Straub) und Wolf Wondratschek (Dwars), Nachruf auf Rosemarie Schuder.
- 29. Südthüringer Literaturwerkstatt (Andreas Seifert, Ursula Schütt, Holger Uske, Sandro Eberwein, Christine Behrend)
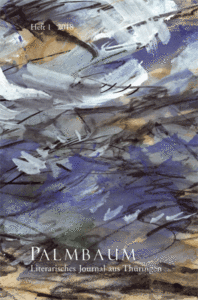
Cover mit der Zeichnung »Thüringer Landschaft« von Gerda Lepke (Freital/Gera)
Heft 66
EDITORIAL
Literaturzeitschriften haben in der Regel nur ein kurzes Leben. Sie sind Zwitter, halb Zeitung, halb Buch. Den einen zu wenig tagesaktuell, den anderen schon zu sehr dem Zeitgeschehen verpflichtet. Ein spektakuläres Programm mag ihnen für den Augenblick Aufmerksamkeit bescheren, ja manchen sogar Ruhm, weit über ihr Bestehen hinaus – wie den Horen Schillers oder dem Athenäum der Romantiker. Oder sie haben eine potente Institution im Rücken wie Sinn und Form die Berliner Akademie der Künste.
Der Palmbaum ist nur ein literarisches Journal aus Thüringen. Umso erstaunlicher, dass es mit diesem Heft sein 25-jähriges Bestehen feiern darf. Wir haben 25 Stammautoren aus ganz Deutschland eingeladen, der Zeitschrift ein paar aufmunternde Worte zu schreiben. Von Wilhelm Bartsch und Thomas Böhme reicht die Schar der Gratulanten über Kerstin Hensel, Wulf Kirsten und Reiner Kunze bis zu Landolf Scherzer, Kathrin Schmidt und B. K. Tragelehn. Herausgekommen ist ein wunderbar abwechslungsreiches Lesebuch, das Lust auf die nächsten 25 Jahre macht.
Zudem bringen wir neue Lyrik u.a. von Christian Rosenau, Christa Cibulka und Philipp Kampa. Im Prosa-Block finden Sie Roman-Auszüge von Rolf Schneider und Waltraud Bondiek sowie eine Geschichte von Doris Wirth.
Ulrich Kaufmann hat Sigrid Damm nach den Hintergründen ihres jüngsten Buches befragt, Detlef Ignasiak erinnert an den 250. Todestag von Winckelmann und Günter Schmidt gedenkt des Schiller-Biografen Reinhard Buchwald.
Den Einband des Jubiläumsheftes hat diesmal Gerda Lepke mit einer Thüringer Landschaft gestaltet – der 25. Palmbaum-Grafik seit 2005.
Lassen Sie sich neue Bücher von unseren Rezensenten empfehlen und lesen Sie auch das Programm der Thüringer Literaturtage sowie die literarischen Höhepunkte des Pfingstfestivals auf Schloss Ettersburg. All dies kündet vom Reichtum der hiesigen Literatur, deren Podium wir noch lange sein wollen. Schreiben Sie uns, was Sie sich von uns wünschen.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: 25 Jahre Palmbaum
- Beiträge von Ulrich Kaufmann (Gespräch mit Detlef Ignasiak über die Anfänge) und Jens‑F. Dwars (Die Palmbäume seit 2005), 25 Gedichte und Geschichten von Wilhelm Bartsch, Matthias Biskupek, Thomas Böhme, Róža Domašcyna, Daniela Danz, Peter Gosse, Kathrin Groß-Striffler, Ralph Grüneberger, Wolfgang Haak, Kerstin Hensel, Nancy Hünger, Annerose Kirchner, Wulf Kirsten, Bärbel Klässner, Reiner Kunze, Steffen Mensching, Stefan Petermann, Andreas Reimann, Lutz Rathenow, Landolf Scherzer, André Schinkel, Kathrin Schmidt, Hans-Dieter Schüt, B.K. Tragelehn, Holger Uske; Grüße von Lese-Zeichen (Martin Straub), Bödecker (Ellen Scherzer) und LGT (Ulf Annel, Ursula u. Siegfried Schütt); Bibliografie der Hefte 50–65.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Gerda Lepke).
- PROSA von Rolf Schneiderr, Doris Wirth und Waltraud Bondiek.
- LYRIK von Christian Rosenau, Christa Cibulka, Roland Bärwinkel, Beate Weston-Weidemann, Philipp Kampa, Joachim Werneburg und Detlef Färber.
- INTERVIEW von Ulrich Kaufmann mit Sigrid Damm.
- WEIMARER LYRINACHT mit Tom Schulz, Ulrike Feibig, Ursula Krechel und Christian Filips.
- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak (Winckelmanns 250. Todestag) ud Günther Schmidt (Reinhard Buchwald)
- NACHRUFE auf Elmar Faber (Dwars) und Hans Richter (Kaufmann)

Cover mit dem Linolschnitt »Utopia«
von Ulrike Theusner (Weimar)
Heft 65
EDITORIAL
Dies ist das erste von zwei aufeinander folgenden Jubiläumsheften: Am 24. August 1617, vor 400 Jahren, wurde in Weimar die Fruchtbringende Gesellschaft gegründet, die erste deutsche Literaturvereinigung. Als Palmenorden, der sich die vielfach nutzbare Palme zum Erkennungszeichen gewählt hatte, waren die Fruchtbringer auch das Vorbild für die Gründung der Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum und ihrer gleichnamigen Zeitschrift, die seit 1993 erscheint. Das nunmehr 65. Heft schließt den 25. Jahrgang ab, weshalb wir im nächsten Frühjahr denn auch Geburtstag feiern werden.
Das vorliegende Heft aber haben wir zunächst den Fruchtbringern gewidmet. Von heute aus gesehen mutet es geradezu utopisch an, dass vor 400 Jahren, am Vorabend des 30-jährigen Krieges, protestantische Fürsten ausgerechnet die Förderung der deutschen Sprache und Literatur quasi zum Regierungsprogramm erhoben! Um den Zusammenhang von Sprache, Macht und Politik wird auch ein Podiumsgespräch kreisen, zu dem der Thüringer Literaturrat und die Herzogin Anna Amalia-Bibliothek am 24. Oktober einladen (siehe Seite 33). Zugleich fragen wir, inwiefern Schriftsteller heute Literaturverbände brauchen – vom VS, über regionale Vereine bis hin zum P.E.N.
Neue Lyrik bringen wir u.a. von Friedrike Haerter, Ullrich Kersten und Wilhelm Bartsch, neue Prosa von Bernd Leistner und Lutz Rathenow. Außerdem erstveröffentlichen wir eine Weihnachtserzählung aus dem Nachlass von Gabriele Reuter. Indem wir die Transkription der Handschrift drucken, erhalten die Leser auch exemplarisch Einblicke in die Werkstatt der Autorin und können an Streichungen und Hinzufügungen verfolgen, wie der Text entstanden ist.
Neben der Weimarer Lyriknacht dokumentieren wir zwei Preisverleihungen: Wir bringen die Dankrede von Christoph Dieckmann zum Caroline-Schlegel-Preis für Essayistik der Stadt Jena sowie Laudatio und Dank des Preisträgers zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Lutz Seiler. Wir verfolgen die Spuren Eugen Diederichs und eines Erfurters, der vor 100 Jahren Korea erkundet hat. Wir befragen einen Wiederentdecker von Goethes Großvater aus dem thüringischen Kannawurf (!) und führen ein Gespräch mit Ulrike Theusner, die uns die Einbandgrafiken geschaffen hat. Und wir laden Sie ein, sich auf sage und schreibe 45 Seiten neue Literatur empfehlen zu lassen. Weihnachten steht vor der Tür …!
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: 400 Jahre Fruchtbringende Gesellschaft
- Beiträge von Christoph Schmitz-Scholemann (Im Zeichen der Palme), Julia Schinköthe & Uta Seewald-Heeg (Die Neue Frucht-bringende Ges. in Köthen), Uwe Pörksen (Leibniz zur dt. Sprache), Jens‑F. Dwars (Heiner Müllers »Umsiedlerin«), Nietzsche (Wahr-heit und Lüge), Ingo von Münch (»Political Correctness«), Nancy Hünger (Schweigen), Kurt Tucholsky (Schriftsteller), Olaf Trunschke (VS), Stefan Petermann (LGT), Matthias Biskupek (PEN).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Ulrike Theusner).
- PROSA von Gabriele Reuter, Bernd Leistner und Lutz Rathenow.
- LYRIK Friederike Haerter, Cornelius van Alsum, Christine Hansmann, Ullrich Kersten, Wilhelm Bartsch.
- ESSAYS von Christoph Dieck-mann (Caroline-Preis), Jens‑F. Dwars (A.W. Schlegel), Ulrich Kaufmann (Lenz beim Kunstfest).
- WEIMARER LYRINACHT mit Tom Schulz, Ulrike Feibig, Ursula Krechel und Christian Filips.
- SPURENSUCHE von Katrin Lemke (Diederichs), Sylvia Bräsel (Otto Lucius), Hans Sarkowicz (Goethes thüringer Großvater)
- Laudatio (Torsten Unger) und Dankrede von Lutz Seiler zum Thüringer Literaturpreis
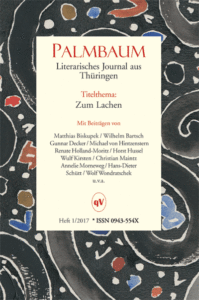
Cover mit einer Zeichnung von Horst Hussel (Berlin)
Heft 64
EDITORIAL
Weimarzentrismus – so lautet ein beliebter Vorwurf gegen alles, was aus Weimar oder dessen Umfeld kommt. Wie die Literarische Gesellschaft, die an der Ilm ihren Sitz hat, oder der Palmbaum, der im Nachbartal wurzelt. Natürlich nervt es auf die Dauer, wenn ein Ort seit 200 Jahren behauptet, die Literaturhauptstadt der Deutschen zu sein und dabei permanent mit alten Karten spielt.
Als sei Alter an sich schon ein Wert. Oder geht es um etwas anderes? Was zieht die Leute wieder und wieder in diese Stadt? Die Sehnsucht nach einer verlorenen Harmonie? Die es niemals gab in diesem Musendorf, wo man um 1800 noch Kühe durch die Gassen trieb, wo ländliche Armut mit kulturell ambitionierter Hofhaltung Hand in Hand ging. Weimar, das heißt „ideell“, immer wieder über die Grenzen des Bestehenden hinaus zu drängen. Und Weimar heißt auch, reell, immer wieder mit hochfliegenden Plänen Schiffbruch zu landen, eingeholt zu werden vom „durchaus Scheißigen“ der irdischen Verhältnisse, wie es Goethe in seinen jüngeren Jahren auf den Punkt zu bringen pflegte.
Die folgenden Beiträge bewegen sich zwischen den Polen des ideellen und des realen Weimar. Sie laden zu erneuter Sicht auf scheinbar Altbekanntes ein und wollen Neugier auf das kommende Weimar wecken, das sich im Hier und Heute wandeln muss. Dass dieser Wandel sich nur im politischen Raum vollziehen kann, haben die vergangenen Monate seit dem letzten Heft deutlich gemacht. Die Diskussionen um die Finanzierung des Kulturstandortes Thüringen, und darüber hinaus die Verfassungs-Debatte um Kultur als „Pflichtaufgabe“ des Staates generell, halten unvermindert an. Der Palmbaum hat in Heft 2/06 mit einem Essay von Peter D. Krause zum inhaltlichen Streit aufgerufen: Welche Kultur wollen wir um welchen Preis? Im vorliegenden Heft stehen erste Erwiderungen. Mögen sie den nötigen Widerspruch provozieren.
Das nächste Mal wollen wir das Netzwerk literarischer Ort nachzeichnen, das die Thüringer Landschaft wie kaum eine andere mit ungeheurer Dichte über Jahrhunderte hinweg durchzieht. Weimar wird dann wieder nur ein Punkt unter vielen sein…
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Zum Lachen
- Beiträge von Annelie Morneweg (Das Komische), Ulrich Kaufmann (Absurditäten von Goethe und Lenz), Jean Paul, Detlef Ignasiak (Goethe scheitert an Kleist), Novalis/Schlegel, Jens‑F. Dwars (Goethes ernste Scherze), Klassiker-Parodien, Nietzsche, Ulf Annel (Ringelnatz in Thüringen), Hans-Dieter Schütt (Jüdischer Humor), Detlef Ignasiak (Spuren jüd. Lebens in Thüringen), Michael von Hintzenstern (Dada-Dekade), Olaf Weber (Der 42. Kongress), Matthias Biskupek (Satireversuche in Web), Renate Holland-Moritz (Lachsalve auf die DDR), Ulf Annel (Schreiben fürs Kabarett), Das Satiricum in Greiz), Sylvia Bräsel (Wortwitz in China).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Horst Hussel).
- PROSA von Stefan Petermann, Gunnar Decker, Matthias Klaß, Martin Straub, Ursula Schütt, Horst Hussel.
- LYRIK von Wolf Wondratschek, Wilhelm Bartsch, Christoph Schmitz-Scholemann, Lutz Rathenow, Dieter Gleisberg, Christian Maintz und Joachim Werneburg.
- ESSAYS von Wulf Kirsten (Gabriele Reuter) Jens‑F. Dwars (E. Förster-Nietzsche-Biografie von K. Decker), Pro & Contra zu einem Büch über Fühmann.
- INTERVIEW mit Roland Krischke über die Zukunft des Lindenau-Museums und des Altenbourg-Hauses in Altenburg
- SPURENSUCHE von Michael Kirschschlager (Heinrich Hetzbold von Weißensee), Detlef Ignasiak (200. Todestag von Dalberg).

Cover mit einer Zeichnung von Strawalde (Berlin)
Heft 63
EDITORIAL
Hand aufs Herz: Wer liest heute noch Gustav Freytag? Vor genau einem Jahr hatten wir das Herbstheft dem Thema „Bestseller“ gewidmet. Freytag ist ein exemplarischer Fall dafür, und das im wortwörtlichen Sinn: vom meistgelesenen Autor und vielgespielten Stückeschreiber zwischen Gründung des Kaiserreichs und Ende der Weimarer Republik ist er zum nahezu Unbekannten abgestürzt, von dem man nur ab und zu raunen hört, sein Roman Soll und Haben sei antisemitisch. Und tatsächlich wurde 1977 eine Verfilmung des Romans durch Rainer Werner Fassbinder mit genau diesem „Argument“ verhindert. Ein Verdikt, das selbst so klischeehaft war wie die Klischees, die man Freytag – und Fassbinder – vorwarf. Herbert Knopp, der damalige Drehbuchautor, erinnert in seinem Beitrag für dieses Heft erstmals ausführlich an die Vorder- und Hintergründe der Ablehnung und zeigt, was dadurch verhindert wurde: ein produktiver Umgang mit dem Stoff, der die antisemitischen Klischees aufarbeiten wollte, indem er sie durchsichtig macht, um die sozialökonomischen Gründe dahinter zu erkennen. Nebenbei gesagt: fast rührend liest man, wie ernst das bundesdeutsche Fernsehen vor 40 Jahren noch seinen Bildungsauftrag nahm – um desto zorniger wahrzunehmen, welche Verblödung eben dieses Medium heute auf nahezu allen Kanälen im Wettrennen um „Einschaltquoten“ betreibt. Wir freuen uns, erstmals auch eine literarische Kunstform dokumentieren zu dürfen, die weitgehend unterschätzt wird: die des Drehbuchs. Wer die Szenen liest, sieht den Film schon vor sich und kann nur bedauern, dass er wegen ideologischer Kurzsichtigkeit – diesmal im Westen Deutschlands – nie zustande kam.
Weitere Höhepunkte des Heftes sind Weimar-Gedichte von Andreas Reimann, ein Text-Zyklus von André Schinkel, Beiträge zur Weimarer Lyriknacht, u.a. von Michael Krüger, der zweite Teil des Essays von Dietmar Jacobsen über die Archäologisierung der DDR in Nach-Wende-Romanen, Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Gerhard Altenbourg und Horst Hussel, eine Erinnerung an Hilbigs Prosa-Debüt in der DDR von Ralph Grüneberger, das Gespräch mit Strawalde, der uns einen zauberhaften Einband gezeichnet hat, und die Beiträge der fünf Finalisten zum Menantes-Preis für erotische Dichtung, der im Juni vom Palmbaum und der Kirchgemeinde Wandersleben verliehen wurde. Mögen Sie nicht zuletzt unsere 30 Seiten Rezensionen zu anregender Lektür verführen.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Gustav Freytag 200
- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Kurzporträt), Cornelia Hobohm (Freytag in Thüringen), Peter Arlt (Freytag-Bildnisse), Siegwart Wohlleben (Freytag-Gedenkstätte Siebleben), Bernt Tur von zur Mühlen (Interview zu seiner Freytag-Biografie), Erstveröffent-lichung eines Briefes von Freytag an einen jungen Autor, Herbert Knopp (zur Verhinderung eines Fassbinder-Films)
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Strawalde).
- PROSA von Elisabeth Dommer, Hansjörg Rothe, Beatrix Heinrichs und André Schinkel.
- LYRIK von Andreas Reimann, Hans-Jörg Dost, Annerose Kirchner, Michael Hillen, Beate Weidemann, Anja Kampmann, Dominik Dombrowski, Martina Hefter und Michael Krüger.
- ESSAYS von Dietmar Jacobsen (Zur Archäologisierung der DDR, Teil II) und Dietmar Maetzig (Litauische Begegnungen).
- SPURENSUCHE von Michael Kirschschlager (Ein Thüringer Bücherdieb), Briefe von Gerhard Altenbourg und Horst Hussel, Ralph Grüneberger (Hilbigs Prosa-Debüt in der DDR)
- MENANTES-PREIS: Michael Hüttenberger, Dagmar Scherf, Hellmuth Opitz, David Lode und Ingrid Svoboda.
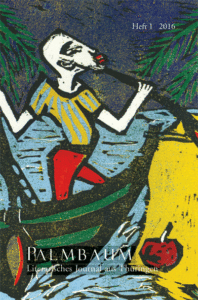
Cover mit dem Farbholzschnitt »Eine Schifffahrt ist nicht lustig« von Klaus Süß (Chemnitz)
Heft 62
EDITORIAL
Übersetzern geht es wie den Kinderbuchautoren. Sagt man von den einen, sie würden doch „nur“ für Kinder schreiben, so von den anderen, dass sie „nur“ übersetzen, was die Originalautoren gedichtet haben. Immer haftet ihnen etwas Sekundäres an. Zumindest im Bewusstsein der Leser spielen sie kaum eine Rolle, denn die Qualität einer Übersetzung kann nur einschätzen, wer das Original kennt.
Grund genug, ein Palmbaum-Heft der Kunst des Übersetzens zu widmen. Wir beginnen mit Luther, dessen kraftvoll bildreiche Bibelübertragung Bahnbrechendes für die deutsche Sprache und Literatur geleistet hat. Wir schauen über Deutschland hinaus und zurück ins Mittelalter, in dem es islamische Gelehrte waren, die den Geist des Abendlandes, das Wissen und Denken der Antike bewahrt haben, als Europa in Barbarei und Aberglaube versank. Und wir befragen heutige Übersetzer nach ihrem Selbstverständnis.
Im Lyrik-Block stellen wir neben neuen Gedichten von Katrin Bibiella und Thomas Böhme auch Texte aus dem Nachlass von Eva und Klaus-Dieter Schönewerk vor, die zu Lebzeiten keine eigenen Bücher veröffentlicht haben. Nun ermöglichen zwei posthum gedruckte Bände der beiden Thüringer erstaunliche Entdeckungen. Auch unter Prosa bringen wir neben einem neuen Text von Kathrin Schmidt eine nachgelassene Erzählung von Siegfried Pitschmann. Das Besondere daran: sie stammt aus dem Mühlhäuser Frühwerk des Autors.
Die Essays von Dietmar Jacobsen und Jürgen Große kreisen um die Wende und die Deutung noch immer währender Differenzen zwischen Ost und West. In zwei Interviews befragen wir Thüringer Autorinnen: Daniela Danz nach ihrem neuen Roman und Marie-Elisabeth Lüdde nach ihrer Herder-Biografie. Weitere Neuerscheinungen empfehlen wir Ihnen auf 30 Seiten Rezensionen. Unter Spurensuche zeigen wir, wie Jena mit seinem Ehrenbürger Johannes R. Becher umgeht. Für den Einband hat der Chemnitzer Klaus Süß einen Farbholzschnitt – ein Boot, das von Ufer zu Ufer übersetzt – in verlorener Form geschaffen. Was sich hinter dieser Technik verbirgt, erfahren Sie im Gespräch mit dem Künstler. – Und zuletzt noch ein Wort in eigener Sache: seit diesem Heft wird der Palmbaum gemeinsam mit dem Thüringer Literaturrat herausgegeben. Er steht damit auf noch breiteren Füßen. Für Sie als Leser ändert sich nichts: wir sind und bleiben das Forum für Literatur aus und über Thüringen.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Die Kunst des Übersetzens
- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Von Ufer zu Ufer), Detlef Ignasiak (Bibelübertragungen vor Luther), Sylvia Weigelt (Luthers Kunst des Übersetzens), Eduardo Costadura (Dante-Übersetzungen um 1800), Karlen Vesper (Wahrung des Abendlandes durchs Morgenland), Stefan Reichmuth (Die Übersetzerin Gisela Kraft), Joachim Werneburg (Im Spiegel der Leila), Ingo Cesaro (Haiku), Lust und Leid des Übersetzens (Peter Gosse, Roza Domašcyna, Wilhelm Bartsch, Christoph Schmitz-Scholemann, Sylvia Bräsel, Richard Pietraß, Andre Schinkel, B.K. Tragelehn)
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Klaus Süß).
- PROSA von Andrea L. Stenzel, Kathrin Schmidt und Siegfried Pitschmann.
- LYRIK von Katrin Bibiella, Thomas Böhme, Eva und Klaus-Dieter Schönewerk.
- ESSAYS von Dietmar Jacobsen (Zur Archäologisierung der DDR), Jens‑F. Dwars (Geist der Stunde) und Jürgen Große (Der Glaube des Westens).
- SPURENSUCHE von Jens‑F. Dwars (Der entsorgte Ehrenbürger: zum 125. von Joh. R. Becher).
- INTERVIEWs: mit Daniela Danz (Roman »Lange Schatten«) und Marie-Elisabeth Lüdde (Herder-Biografie).
- REZENSIONEN: über 30 Seiten.
- NACHRICHTEN: u.a. Programm der Thüringer Literaturtage auf Burg Ranis im Juni 2016.
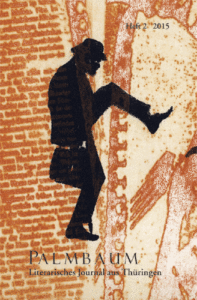
Cover mit der Radierung »Monty trifft Eisenstein« von Heike Stephan (Löhma)
Heft 61
EDITORIAL
Verlag und Redaktion freuen sich, wenn ein Heft ausverkauft ist. Dass uns das nun zweimal hintereinander in jeweils nur zwei Monaten geschehen ist, lässt vermuten, dass wir doch nicht alles verkehrt machen. Freilich waren die Hefte auch großen Themen gewidmet: mit Shakespeare lockte der Dramatiker der Neuzeit schlechthin, mit Gerhard Altenbourg ein faszinierender Bilderpoet, der noch immer Rätsel aufgibt. Das Titelthema des vorliegenden Heftes lautet diesmal weniger spektakulär: Märchen einst und heute. Das mag auf den ersten Blick mitleidiges Lächeln hervorrufen. Was sind schon Märchen? Einschlafgeschichten für kleine Kinder. Und doch gehören die Grimmschen Hausmärchen neben Luthers Bibel und dem Marxschen Manifest zu den weltweit meistgedruckten Büchern deutscher Sprache. Dabei stammte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die meistgelesene Märchensammlung vom Meininger Archivar Ludwig Bechstein. Andreas Seifert erinnert an den Schriftsteller, Sammler und Herausgeber. Rainer Hohberg erkundet die erstaunliche Vielfalt Thüringer Märchendichtungen von Wieland und Musäus über Goethe bis zum Vorreiter des Sciencefiction-Romans Kurt Laßwitz. Und wir bringen Märchen heutiger Autoren: von zeitgemäßen Fassungen alter Klassiker über erotische Varianten von Matthias Biskupek und Kerstin Hensel bis zu aberwitzig grotesken Märchen für Erwachsene von Stefan Petermann, Lutz Rathenow und Hubert Schirneck.
Neue Prosa stammt u.a. von Friedrich Dieckmann und Vera Kissel. Neben einem Block zur Lyrik aus Südthüringen gibt es neue Gedichte von André Schinkel und Michael Hillen. Unter Essay finden Sie Betrachtungen von Dietmar Maetzig über Litauische Holzfiguren als archische Erinnerungsträger und ein furioses Loblied auf Kleindarsteller von Hans-Dieter Schütt. Detlef Ignasiak hat ein bislang unbekanntes Dichterhaus in Jena entdeckt und ein ganzer Block erkundet, was Thüringer Theater in diesem Frühjahr bieten!
Die Einbandzeichnung stammt von Moritz Götze, dessen comicartig bunte Bilderwelt von Abgründen unterminiert ist – wie jedes gute Märchen. Lesen Sie am Ende das Programm der Thüringer Literaturtage, lassen Sie sich von 28 Seiten Literaturempfehlungen verführen und schauen Sie einmal auf das neue Webportal Literaturland Thüringen. Auch wenn es eine märchenhaft gute Zeitschrift natürlich nicht ersetzen kann …
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Bestseller im Wandel der Zeiten
- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Menantes‹ Strategien), Alexander Kosenina (Bestseller der Goethezeit), Cornelia Hobohm (Die Schnitt-Technik der Marlitt), Jens Kirsten (Harry Domela), Matthias Biskupek (Bestseller Ost), Hans-Dieter Schütt (Bestseller West), Achim Wünsche (Sex sells), Ulrich Holbein (Wolfgang und Ulrich), Pro & Contra zu Safranskis Goethe (Schütt vs. Dwars)
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Heike Stephan).
- PROSA von Andrea L. Stenzel, Claudia Paal, Paul Scheerbart, Inge Häußler und Verena Zeltner.
- LYRIK von Christian Rosenau, Matthias Biskupek, Thomas Rackwitz, Ingo Cesaro, Cornelius van Alsum, Ulrich Koch, Brigitte Ole-schinski, Karla Reimert und Hans Thill.
- ESSAYS von Bernd Leistner (Thomas Mann), Ingeborg Stein (Heinrich Schütz), Friedrich Nietzsche (Was den Deutschen abgeht)
- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak (Löbichauer Musenhof) und Achim Wünsche (Christiane Vulpius)
- INTERVIEW: Paul Scheerbart.
- Thüringer Literaturpreis: Laudatio von Hans Sarkowicz und Dankrede von Wulf Kirsten; daneben Dankrede von Nancy Hünger zum Gerlach-Stipendium
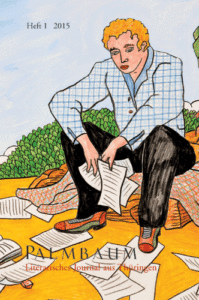
Cover mit der Zeichnung »Wir betrachten die Handlung« von Moritz Götze (Halle)
Heft 60
EDITORIAL
Verlag und Redaktion freuen sich, wenn ein Heft ausverkauft ist. Dass uns das nun zweimal hintereinander in jeweils nur zwei Monaten geschehen ist, lässt vermuten, dass wir doch nicht alles verkehrt machen. Freilich waren die Hefte auch großen Themen gewidmet: mit Shakespeare lockte der Dramatiker der Neuzeit schlechthin, mit Gerhard Altenbourg ein faszinierender Bilderpoet, der noch immer Rätsel aufgibt. Das Titelthema des vorliegenden Heftes lautet diesmal weniger spektakulär: Märchen einst und heute. Das mag auf den ersten
Blick mitleidiges Lächeln hervorrufen. Was sind schon Märchen? Einschlafgeschichten für kleine Kinder. Und doch gehören die Grimmschen Hausmärchen neben Luthers Bibel und dem Marxschen Manifest zu den weltweit meistgedruckten Büchern deutscher Sprache. Dabei stammte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die meistgelesene Märchensammlung vom Meininger Archivar Ludwig Bechstein. Andreas Seifert erinnert an den Schriftsteller, Sammler und Herausgeber. Rainer Hohberg erkundet die erstaunliche Vielfalt Thüringer Märchendichtungen von Wieland und Musäus über Goethe bis zum Vorreiter des Sciencefiction-Romans Kurt Laßwitz. Und wir bringen Märchen heutiger Autoren: von zeitgemäßen Fassungen alter Klassiker über erotische Varianten von Matthias Biskupek und Kerstin Hensel bis zu aberwitzig grotesken Märchen für Erwachsene von Stefan Petermann, Lutz Rathenow und Hubert Schirneck.
Neue Prosa stammt u.a. von Friedrich Dieckmann und Vera Kissel. Neben einem Block zur Lyrik aus Südthüringen gibt es neue Gedichte von Andre Schinkel und Michael Hillen. Unter Essay finden Sie Betrachtungen von Dietmar Maerzig über Litauische Holzfiguren als archische Erinnerungsträger und ein furioses Loblied auf Kleindarsteller von Hans-Dieter Schütt. Detlef Ignasiak hat ein bislang unbekanntes Dichterhaus in Jena entdeckt und ein ganzer Block erkundet, was Thüringer Theater in diesem Frühjahr bieten!
Die Einbandzeichnung stammt von Moritz Götze, dessen comicartig bunte Bilderwelt von Abgründen unterminiert ist – wie jedes gute Märchen. Lesen Sie am Ende das Programm der Thüringer Literaturtage, lassen Sie sich von 28 Seiten Literaturempfehlungen verführen und schauen Sie einmal auf das neue Webportal Literaturland Thüringen. Auch wenn es eine märchenhaft gute Zeitschrift natürlich nicht ersetzen kann …
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Märchen einst & heute
- Beiträge von Rainer Hohberg (Thüringer Märchen), Andreas Seifert (Ludwig Bechstein), Dana Kern (Thüringer Märchentage 2015 in Meiningen), Johannes Wunderlich (Der Alltag eines Märchenerzählers) und neuen Märchen von Vera Zeltner, Klaus Paffrath, Astrid Seehaus, Hubert Schirneck, Dietlind Steinhöfel, Stefan Petermann, Lutz Rathenow, Siegfried Schütt, Elisabeth Dommer, Jens‑F. Dwars, Ingrid Annel, Kerstin Hensel, Matthias Biskupek und Rainer Hohberg.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Moritz Götze).
- PROSA von Matthias Biskupek, Friedrich Dieckmann, Rudolf Köhler, Vera Kissel und Philipp Mahlich.
- Südthüringer Lyrik mit Holger Uske, Horst Wiegand, Reiner Mund und Karl-Heinz Großmann.
- Neue GEDICHTE von André Schinkel, Katharina Poitz. Michael Hillen und Wolfgang Haak.
- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak zu Toni Schwabe in Jena..
- THEATER: Ulrich Kaufmann über den Weimarer »Hofmeister«.
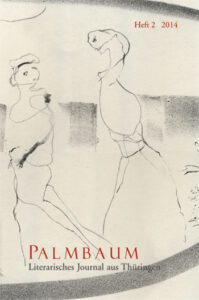
Cover mit der Lithografie »Empusa-Monstranz« (1982)
von Gerhard Altenbourg (Altenburg)
Heft 59
EDITORIAL
Als Gerhard Altenbourg am 30. Dezember 1989 an den Folgen eines Autounfalls starb, hinterließ er ca. 3000 Zeichnungen und Farbblätter, 200 Lithografien, 269 Holzschnitt-Kompositionen, 217 Radierungen, zahlreiche Künstlerbücher, Plastiken und Raumgestaltungen in Haus und Garten als ein Gesamtkunstwerk. Das vorliegende Heft möchte zeigen, wie stark dieses Werk in Thüringen verwurzelt ist. Es verfolgt die Lebensspur des Künstlers von seiner Geburt in Rödichen-Schnepfenthal über das Weimarer Jahrzehnt von 1948 bis 1958 bis zu seinem Wirken in Altenburg, wo er autonom, von der Öffentlichkeit der DDR teils ausgeschlossen, teils sich selbst zurück ziehend, und dennoch durch ein Netz lebendiger Kontakte mit der internationalen Kunstwelt verbunden, seinen eigenen Kosmos schuf. Wir sind keine Kunstzeitschrift und können daher nur wenige Grafiken zeigen, für deren Abdruckrechte wir der Stiftung Gerhard Altenbourg danken. Allein die Titel dieser Arbeiten verraten, dass er zugleich ein Dichter war. Sein literarischer Nachlass harrt noch gründlicher Erschließung, so dass wir im Folgenden nur mit wenigen Beispielen das lyrische Werk des Zeichners andeuten, ohne den Anspruch auf eine repräsentative Auswahl.
Der zweite Schwerpunkt des Heftes ist Wulf Kirsten gewidmet. Wir freuen uns, neben neuen Gedichten die Festrede von Christoph Schmitz-Scholemann zum 80. Geburtstag des Schriftstellers sowie dessen Dankesworte drucken zu dürfen, in denen der Dichter sein durchaus schwieriges Verhältnis zu Weimar bilanziert.
Wie in jedem Herbst dokumentieren wir die Mitteldeutsche Lyriknacht, bringen neue Prosa und einen Essay über Claude Simon. Unter der Rubrik Spurensuche erinnern wir an Ricarda Huchs Jenaer Jahre und drucken ein Interview mit Christa Grimm zur Wiederentdeckung eines Romans über den Ersten Weltkrieg.
Im Gespräch mit Julia M. Nauhaus, der Direktorin des Lindenau-Museums, erfahren Sie mehr über den Nachlass von Gerhard Altenbourg und den Einband unseres Heftes, dem eine Lithografie mit dem seltsamen Titel Empusa-Monstranz zugrunde liegt.
Allein 30 Seiten umfassen unsere Rezensionen – ein Luxus in der heutigen Medienlandschaft! Und zuletzt bringen wir noch die Beiträge der Finalisten zum Wettbewerb um den Menantes-Preis für erotische Dichtung. Ordentlich Lesefutter für die kommenden Regentage.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Gerhard Altenbourg
- Beiträge von Friedrich Dieckmann (Zum Namen Altenbourg), Frank Lindner (A.s Geburtshaus in Rödichen-Schnepfenthal), Jens‑F. Dwars (A. in Weimar), Jutta Penndorf (A. und das Lindenau-Museum), Ilse M. Franke (Zur Erfurter Atelierge-meinschaft), Horst Hussel (drei Grafiken für A.), Jo Fried (Brief-wechsel mit Lothar Lang), Dieter Gleisberg (Zur Ausstellung 1986), Frank u. Christa Grimm (Nachbar A.), Peter Schnürpel (A.s Zeichentisch), Willi Heining (Leser A.), Ingo Schulze (Aus: Neue Leben), Gerhard Alten-bourg (Gedichte und Notate).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Julia M. Nauhaus über Altenbourg).
- PROSA von Dietrich Hucke, Sabine Haupt und Dmitrij Gawrisch.
- Zum 80. Geburtstag von WULF KIRSTEN neue Gedichte von W.K., Laudatio von Christoph Schmitz-Scholemann, Dankrede von W. K. über »Weimar als sicherer Ort«.
- MITTELDEUTSCHE LYRIKNACHT: Gedichte von Ulrich Zieger, Jörg Bernig, Silke Scheuermann, Robert Loth und Barbara Köhler.
- INTEVIEW mit Julia M. Nauhaus über den Nachlass Altenbourgs sowie mit Christa Grimm über den Weltkriegsroman »Schlump«.
- SPURENSUCHE zu Ricarda Huch in Jena (Katrin Lemke) und Essay über Claude Simon (Philipp Kampa).
- LITERARISCHES LEBEN:
Abschied von Wolfgang Held und Werner Liersch, Beiträge der Finalisten zum Menantes-Preis für erotische Dichtung von Uwe Kolbe, Nancy Hünger, Bernd Daschek, Axel Dreppec und Boris Semrow, Ausschreibung Junges Literatur-Forum Hessen-Thüringen.
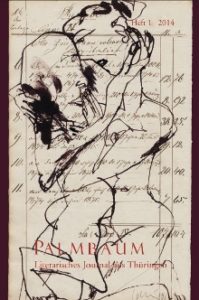
Cover mit einer Zeichnung von Peter Schnürpel (Altenburg)
Heft 58
EDITORIAL
Shakespeare wird 450 und wir ehren ihn á la Brecht, indem wir uns nützen: Wir haben Kenner und Könner eingeladen, über das Jahrtausendgenie nachzudenken. Detlef Ignasiak bilanziert den noch immer andauernden Streit um den Verfasser, der sich hinter dem Markenzeichen „Shakespeare“ verbirgt, und deutet an, wie die Kenntnis seiner Stücke nach Thüringen kam – über fahrende Schauspieltruppen. Sylke Kaufmann hinterfragt die Pionierrolle, die Lessing bei der deutschen Rezeption des Dramatikers zugeschrieben wird und Peter Schütze zeigt am Beispiel von Wieland, Schlegel und Ernst Ortlepp, wie verschieden man den Engländer übersetzen kann. Über dessen Weimarer Denkmal berichten Balz Engler und Dietrich Hucke, während Roland Petersohn an Heiner Müller erinnert. Shakespeare-Sonette hat Harry Weghenkel übersetzt und von B. K. Tragelehn bringen wir Gedichte zu Shakespeares Stücken.
Neue Prosa finden Sie von Ingeborg Stein, Lutz Rathenow und Annerose Kirchner. Aus dem Nachlass von Gisela Kraft ist soeben eine Autobiografie erscheinen, aus der wir einen Auszug drucken. Im Lyrik-Teil stellen wir u.a. Hans Georg Bulla und Róza Domašcyna vor, Daniela Danz befragen wir nach ihrem neuen Gedichtband.
Unter Essays erinnert sich der Fotograf Dietmar Riemann an die Entstehung eines Bildbandes, um dessen Erscheinen Franz Fühmann lange gerungen hat: Was für eine Insel in was für einem Meer.
Unter Spurensuche geht Gerhard R. Kaiser dem Wirken des Weimarer Unternehmers und Herausgebers Friedrich Justin Bertuch nach. Und Detlef Ignasiak gedenkt des Theaterherzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen.
Für den Einband hat der Altenburger Maler und Grafiker Peter Schnürpel uns kraftvolle Zeichnungen auf Kontorpapier von 1850 zur Verfügung gestellt. Lesen Sie das Gespräch mit ihm.
Und vielleicht sehen wir uns ja am 14. Juni im Pfarrhof von Wan-dersleben: zum Finale um den Menantes-Preis für erotische Dichtung, den der Menantes-Förderkreis der dortigen Kirchgemeinde seit 2006 alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Palmbaum verleiht. Oder wollen Sie sich noch beteiligen? Bis 31. März besteht die Gelegenheit dazu. Die Ausschreibung finden Sie auf Seite 207.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Shakespeare 450
- Beiträge von Detlef Ignasiak (Zum Streit um die Identität Shakespeares und über frühe englische Schauspieltrupps in Thüringen), Sylke Kaufmann (Lessing), Peter Schütze (Ortlepps Übersetzungen zwischen Wieland und Schlegel), Balz Engler und Dietrich Hucke über Shakespeare-Denkmäler, Roland Petersohn (Heiner Müller), Shakespeare-Sonette von Harry Weghenkel und Gedichte zu Shakespeare-Stücken von B .K. Tragelehn sowie eine Umfrage unter den Thüringer Theatern nach Shakespeare heute.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Peter Schnürpel)
- PROSA von Ingeborg Stein, Lutz Rathenow, Gisela Kraft und Annerose Kirchner
- LYRIK von Hans Georg Bulla, Roza Domascyna, Sascha Kokot, Joachim Werneburg und ein Gespräch mit Daniela Danz
- ESSAY von Dietmar Riemann über das Buch »Was für eine Insel in was für einem Meer« mit Fühmann
- INTEVIEW mi Thomas Föhl über den Briefwechsel zwischen Elisabeth Förster-Nietzsche und Harry Graf Kessler
- SPURENSUCHE zu Friedrich Justin Bertuch (Gerhard R. Kaiser) und dem Theaterherzog Georg II. (Detlef Ignasiak).
- LITERARISCHES LEBEN:
Erinnerung an Enerhard Haufe,
das Programm der Thüringer Literaturtage 2014 u.a.

Cover mit einer Farbkomposition in Mischtechnik von Roger Bonnard (Weimar)
Heft 57
EDITORIAL
Den 20. Geburtstag des Palmbaums haben wir zwar schon im Frühjahr gefeiert – mit zwei Ausstellungen und vier Leseabenden – doch so ein Jubiläumsjahr geht ja weiter. Also steigern wir uns zum Ausklang noch einmal und legen Ihnen mit diesem Heft das bislang umfangreichste der Zeitschrift vor: 276 prall gefüllt Seiten.
Unser Titelthema widmet sich dem Literaturland Thüringen. Unter diesem Kennwort plant der Thüringer Literaturrat ein Webportal, das die Breite und Vielfalt der hiesigen Literatur in Vergangenheit und Gegenwart für jeden und jede leicht zugänglich machen und dabei auch auf den Fundus des Palmbaums zurückgreifen soll. Wir beginnen mit der Skizze zu einer Thüringer Literaturgeschichte vom Palmbaum-Gründer Detlef Ignasiak. Wilhelm Bartsch erkundet mit der heiligen Radegunde die literarischen Anfänge, Sebastian Hennig zeigt uns mit Jean Paul einen Außenseiter der Klassik, Jens Kirsten bedenkt das Janusgesicht Weimars und André Schinkel erinnert sich an seine Zeit als Stadtschreiber in dem kleinen Ort Ranis.
Vielleicht ist es gerade das Abseitige, das Kleinteilige, das den Reichtum der Thüringer Literatur ausmacht. Das scheinen auch die Antworten heutiger Autoren nahezulegen, die wir gefragt haben, was sie in Thüringen hält und inwieweit dieses Land ihr Schreiben prägt.
Erneut dokumentieren wir die Mitteldeutsche Lyriknacht, bringen neue Prosa, Gedichte und Essays. Spannung verspricht der neue Roman der viel gelesenen Jugendbuchautorin Antje Babendererde. Sie greift ein Thema auf, das Neugier, aber auch Ängste weckt: die Rückkehr der Wölfe nach Thüringen. Lesen Sie unser Interview.
Wir erinnern an Inge von Wangenheim, stellen den Maler und Grafiker Roger Bonnard vor, der die geheimnisvoll leuchtende Farbkomposition für den Einband geschaffen hat, und bringen 30 (!) Seiten Rezensionen. Doch damit nicht genug. Es folgt ein furioses Finale: Im letzten Drittel dokumentieren wir gleich zwei Preisverleihungen. Wir drucken jeweils die Laudatio und die Dankesreden zur Ehrengabe der Schillerstiftung an Jürgen K. Hultenreich sowie zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Kathrin Schmidt.
Zuletzt sei Ihnen noch ein Blick auf unser Frontispiz empfohlen: dort finden Sie die Vorzugsgrafik, die Karl-Georg Hirsch zum 20. Geburtstag der Zeitschrift gestochen hat. Nur wenige Exemplare sind noch im Verlag erhältlich. Fragen Sie nach!
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Literaturland Thüringen
- Umfrage: Warum Thüringen?
Antworten von Wulf Kirsten, Nancy Hünger, Hubert Schirneck, Landolf Scherzer, Kathrin Groß-Striffler, Matthias Biskupek, Stefan Petermann, Annerose Kirchner, Wolfgang Haak, Daniela Danz und Wolfgang Held.
Umrisse einer Thüringer Literaturgeschichte von Detlef Ignasiak und Beiträge von Wilhelm Bartsch (Radegunde), Sebastian Hennig (Jean Paul), Jens Kirsten (Weimars Janusgesicht) und André Schinkel (Ranis). - MITTELDEUTSCHE LYRIKNACHT mit Roland Bärwinkel, Kerstin Becker, Sascha Kokot, Lars Reyer, Brigitte Struzyk.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Roger Bonnard)
- PROSA von Claudia Paal, Stefan Petermann, Christine Hansmann und Wolfgang Haak.
- LYRIK von Hans-Jürgen Döring, Margarete Wein, Michael Hillen, Cornelius van Alsum und Thomas Rackwitz
- ESSAYS von Ingeborg Stein (über Erika John), York-Gothart Mix (über Wachters Amy Winhouse) und Wofram Malte Fues (Was ist modern?)
- INTEVIEW mi Antje Babendererde über ihren Roman »Isegrim«
- SPURENSUCHE zu Inge von Wangenheim (Heidemrie Förster-Stahl).
- LITERARISCHES LEBEN:
Thüringer Literaturpreis an Kathrin Schmidt mit Laudatio von Gerhrd R. Kaiser und Dankrede sowie Ehrengabe schillerstiftung an Jürgen K. Hultenreich mit Preisrede von Jens Kirsten und Dankrede;
Ausschreibung Menantes-Preis 2014

Cover mit einem Holzschnitt von Karl-Georg Hirsch (Narsdorf)
Heft 56
EDITORIAL
Vor 20 Jahren erschien das erste Heft des Palmbaums. Den Geburtstag feiern wir gleich dreimal: Zunächst auf der Leipziger Messe, dann mit einer Ausstellung vom 7. März bis 18. April in der Jenaer Villa Rosenthal, wo wir unsere Einbandgrafiken zeigen, und schließlich zur Eröffnung der Literaturtage auf Burg Ranis am 20. Juni. Genaueres erfahren Sie unter „Nachrichten“. – Passend zum Jubiläum haben wir uns ein besonderes Titelthema gewählt: Buchkunst. Wir beginnen mit der Umfrage, was denn ein schönes Buch ist? Anschließend stellen wir Beiträge zur Kunst der Buchgestaltung in Thüringen vom Mittelalter bis zur Gegenwart vor. Neue Prosa bringen wir u.a. von Urula Schütt, Elisabeth Dommer und der Jenaer Stadtschreiberin Vera Kissel. Im Lyrik-Teil stellen wir die besten Beiträge zum Wettbewerb um den Walter Werner Preis vor, der 2012 zum ersten Mal vom Provinzkultur e.V. Suhl ausgeschrieben wurde. Außerdem bringen wir neue Gedichte der Gerlach-Stipendiatin Daniela Danz.
Zum 200. Todestag von Wieland wollten wir nicht zum 100. Male die üblichen Daten aus Leben und Werk des Klassikers abspulen. Wir haben deshalb Wieland-Kenner und ‑Bekenner gefragt, warum man ihn heute lesen soll? Jan Philipp Reemtsma, Klaus Manger und der Maler Horst Peter Meyer haben geantwortet. Eine Entgegnung auf den Essay „Wir Künstler, die Lakaien“ von Alban Nikolai Herbst in Heft 2/2012 bringen wir von Ralph Grüneberger. Und Wolfgang Holler beantwortet kritische Fragen zur neuen Dauerausstellung im Goethe-Nationalmuseum. Die Literarische Spurensuche ist diesmal u.a. Otto Ludwig, Richard Wagner und der eigentlichen Begründerin des Weimarer Musenhofes gewidmet: Dorothea Maria von Anhalt.
Wir freuen uns, dass wir für den Einband einen der erfahrensten deutschen Buchgestalter gewinnen konnten: Karl-Georg Hirsch, der in diesem Frühjahr 75 wird. Das Heft ist auch eine Verneigung vor seinem Werk. Natürlich kreist das Gespräch mit ihm noch einmal um die Frage, was ein schönes Buch ausmacht. Doch das Schönste: der Meister ließ sich von unserem Signet verführen, zum 20. Geburtstag der Zeitschrift eine Vorzugsgrafik zu stechen. Bei Drucklegung des Heftes war sie noch nicht fertig. Nur soviel sei verraten: es ist ein zauberhafter Irisdruck mit dem Titel „Am Palmbaum“. Erstmals vorgestellt wird er zum Abschluss der Jenaer Ausstellung am 16. April. Freuen Sie sich darauf!
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Buchkunst
- Umfrage: Was ist ein schönes Buch?
Antworten von Baldwin Zettl, Gerd Sonntag, Elmar Faber, Peter Arlt, Herbert Kästner, Carsten Wurm, Peter Gosse, Hubert Schirneck, Wilhelm Bartsch, Kathrin Paasch, Alexandra Sender. Beiträge zur Geschichte Thüringer Buchkunst von Sylvia Weigelt (Landgrafenpsalter), Matthias Hageböck (Buchbinder der Reformation), Jens‑F. Dwars (Titelblätter von Barock bis Moderne), Jena Henkel (Max Thalmann), Johannes Mangei (DDR-Künstlerbücher), Matthias Biskupek (heute), Wolfgang Knop (Künstlerbriefe).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Karl-Georg Hirsch)
- PROSA von Andreas Budzier, Ursula Schütt, Christian Wöllecke, Vera Kissel, Ralf Krüger, Elisabeth Dommer, Verena Zeltner.
- LYRIK von Horst Wiegand, Kristina Stanczewski, Christian Rosenau, Danioela Danz.
- ESSAY von Ralph Grüneberger.
- SPURENSUCHE zu Wieland (Jan Philipp Reemtsma, Klaus Manger, Horst Peter Meyer), Dorothea Maria von Anhalt (Ellen Seßar-Karpp), Johanna Susanna Bohl und Richard Wagner (Detlef Ignasiak), Caroline von Wolzogen (Christine Theml), Otto Ludwig (Sebastian Hennig).
- LITERARISCHES LEBEN:
u.a. UA von Volker Braun im Theater Rudolstadt, Dichtergarten in Wandersleben, Thüringer Literaturtage in Ranis.

Cover mit einer Zeichnung von Erik Buchholz (Gera)
Heft 55
EDITORIAL
Mit diesem Heft schließt der Palmbaum seinen 20. Jahrgang ab. Wir finden, das ist ein schöner Anlass sich umzuschauen, einmal genauer zu sehen, was das Medium Literaturzeitschrift in Vergangenheit und Gegenwart auszeichnet, welche Ansätze einst erprobt wurden und welche Vielfalt es heute noch gibt. So mögen sich die Leser am Ende selbst ein Urteil über den Stellenwert dieses Journals bilden, das seit 20 Jahren versucht, ein Fenster für Thüringen zu sein: ein Forum, das Einblicke in die hiesige Literaturlandschaft ermöglicht und umgekehrt auch Ausblicke in den Betrieb jenseits unserer Hügel und Täler.
In dem Sinne bringen wir auch wieder neue Prosa und Lyrik. Der Jenaer Stadtschreiber Peter Wawerzinek nimmt uns auf skurrile Weise mit nach Amerika. Auch Steve Kußin und Roland Bärwinkel verhüllen eher, was sie zu berichten vorgeben. Drei schöne Beispiele indirekten Erzählens. Nimmt der Lyrik-Block mit neuen Gedichten von sechs Autoren, darunter Nancy Hünger, Hans-Georg Bulla und Lutz Rathenow, schon einen breiten Raum ein, wird er zudem noch durch die Mitteldeutsche Lyriknacht ergänzt, die am 18. Oktober wieder im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere stattfinden wird. Wir stellen die fünf Teilnehmer mit je zwei Gedichten vor.
Unser Aufruf vom vorigen Heft, mit Christa Wolf nach dem Bleibenden jener Literatur zu fragen, die in der DDR entstanden ist, stieß auf eine merkwürdige Resonanz: Kein einziger Leser hat uns eine Antwort gesandt. Obwohl wir ausdrücklich darum baten, nicht nur auf „die“ DDR-Literatur zu sehen, sondern auch auf jene, die hierzulande geschrieben, aber nicht oder nur illegal veröffentlicht wurde. Wie spannend dieser Gegenstand sein kann, hat in Weimar ein Podium über Samisdat-Zeitschriften im DDR-Untergrund gezeigt. Wir berichten darüber in diesem Heft. Und vielleicht stößt ja der Beitrag von Alban Nikolai Herbst auf den gewünschten Widerspruch: der Künstler, warnt er, werde aus Sorge um seine Versorgung immer mehr zum Lakaien des Zeitgeistes.
Ein großer Block ist diesmal der Literarischen Spurensuche vorbehalten. Lesen Sie das Gespräch mit Erik Buchholz, der den zauberhaft versponnenen Einband für unser Heft geschaffen hat, und genießen Sie am Ende die Beiträge der fünf Finalisten zum Menantes-Preis für erotische Dichtung, der im Juni im Pfarrhof von Wandersleben vergeben wurde.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Literaturzeitschriften
- Beiträge von Klaus Schwarz (Athaeneum), Cornelia Hobohm (Marlitt und die Gartenlaube), Bernd Leistner (Sinn und Form), Jens‑F. Dwars (Peter Weiss‹ Entdeckung in den »Akzenten« 1959).
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Erik Buchholz)
- PROSA von Peter Wawerzinek, Steve Kußin, Roland Bärwinkel.
- LYRIK von Richard Pietraß, Nancy Hünger, Hans Georg Bulla, Carmen Winter, Michael Hillen, Lutz Rathenow.
- ESSAY mit Alban Nikolai Herbst und Klaus Krippendorf.
- SPURENSUCHE zu Sibylle von Kleve (Weigelt), Wilhelm Bode (Riederer), R. J. Sorge (Schaumann), Bodo Kühn (Fechner), Jutta Hecker (Rehbein), Strittmatter (Kauf-mann).
- MITTELDEUTSCHE LYRIKNACHT mit Sandra Trojan, Moritz Gause, Ralph Grüneberger, Rainer Kirsch, Thomas Kunst.
- LITERARISCHES LEBEN:
u.a. die fünf Finalbeiträge zum Menantes-Preis für erotische Dichtung (Klässner, Stephenson, Müser, Bondiek, Schütt).

Cover mit einer Collage von Gerlinde Böhnisch-Metzmacher (Jena)
Heft 54
EDITORIAL
Kinderbücher stehen selten im Fokus des literarischen Interesses. Weil sie ja „nur“ an Kinder gerichtet sind, die noch nicht lesen können oder erst damit beginnen, glaubt man, ihr Anspruch und ihre Leistung seien geringer. Und selbst, wenn ein Buch den Adressaten gefällt, gilt das nicht als Qualitätsausweis, haben die doch noch kein geschultes Urteilsvermögen.
Vielleicht aber sind Kinder gerade deshalb die besseren, die unverdorbenen Leser, die sich von keinem Kritiker vorschreiben lassen, was ihnen gefallen soll? „Keine Kunst? Höchste Kunst!“ lautet daher das Titelthema unseres Heftes. Wir haben Autoren befragt, warum sie für Kinder schreiben. Die Resonanz hat uns selbst überrascht. Es bleibt dabei: Bücher für Kinder und Jugendliche sind der Jungbrunnen aller Literatur, seit ihren Anfängen – den Märchen und Sagen. Denn, wer junge Leute mit Worten berühren will, der muss sich selbst verjüngen und an die Wurzeln aller Poesie gehen – an die Zauberkraft der Sprache in ihren einfachsten Elementen. Reiner Kunze hat dies im vergangenen Jahr mit den Kindergedichten Was macht die Biene auf dem Meer? bewiesen. Wir freuen uns, mit seinen Antworten unser Titelthema eröffnen zu dürfen. Neben den Erwachsenen lassen wir aber auch schreibende Kinder und Jugendliche selbst zu Wort kommen: mit Beiträgen zu den Wettbewerben des Thüringer Buchlöwen und des Literaturforums Hessen-Thüringen. Dazu passt das Gespräch, das Friedhelm Berger mit Prof. Dr. Edwin Kratschmer über dessen grandiose Sammlung von 100.000 Kinder- und Jugendgedichten aus der DDR geführt hat. Wie entstand die Sammlung? Welche Zensurmechanismen beschränkten ihre Veröffentlichung in der DDR? Und was verrät sie über die Anfänge des Schreibens zu allen Zeiten?
Neue Prosa bringen wir von Bärbel Klässner, Anne Gallinat und Ralf Schönfelder. Neue Lyrik u.a. von Wilhelm Bartsch, André Schinkel und Uwe Lammla. Dazu gewähren wir Einblick in einen skurrilen Theatermonolog von Jan Decker: Eckermann packt aus …
Unter Essay gedenken wir Christa Wolfs. Wir wollen sie ehren, indem wir uns nützen: „Was bleibt?“ Mit dieser Frage der streitbaren Autorin und zwei konträren Antworten eröffnen wir eine Debatte über das Bleibende jener Literatur, die in der DDR entstanden ist. Es wird Zeit, vorschnelle Urteile zu revidieren. Schreiben Sie uns, je kontroverser, desto besser.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Kinderbücher
- Beiträge von Reiner Kunze, Antje Babendererde, Hubert Schirneck, Ulf und Ingrid Annel, Dietlind Steinhöfel, Rainer Hohberg u.v.a.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Gerlinde Böhnisch-Metzmacher)
- PROSA von Bärbel Klässner, Anne Gallinat, Ralf Schönfelder.
- LYRIK von Wilhelm Bartsch, André Schinkel, Holger Uske, Ursula Schütt und Johannes-Paul Kögler.
- ESSAY mit Rudi Berger und Friedhelm Berger.
- SPURENSUCHE zu Johann Stigel, Christian August Vulpius und Rudolf Hagelstange.
- INTERVIEW mit Edwin Kratschmer über 100.000 DDR-Jugendgedichte
- LITERARISCHES LEBEN:
u.a. Programme der Thüringer Literaturtage und der PEN-Tagung in Rudolstadt.

Cover mit dem Holzschnitt »Pilgerweg« von Martin Max (Weimar)
Heft 53
EDITORIAL
Auf den Knien seines Herzens hatte Kleist ihm die Penthesilea zugesandt. IHM, dem Dichtergott in Weimar. Der fand, sie sei aus einem allzu „wunderbaren Geschlecht“, ihm herzlich fremd. War Goethe blind für das Talent des anderen oder spürte er es nur zu genau und brachte er den Zerbrochenen Krug gar mit Absicht auf seinem Theater zum Scheitern? Lesen Sie unser Titelthema: Heinrich von Kleist – mit Beiträgen von Jochen Klauß, Volker Braun, Bernd Leistner, Klaus Bellin, Jürgen K. Hultenreich, André Schinkel und Horst Peter Meyer.
Merkwürdig geht es im Prosa-Block zu – mit Geschichten über Randfiguren. Schon zum 10. Mal findet am 3. November die Mitteldeutsche Lyriknacht statt, erneut im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere. Vorab bringen wir eine Textauswahl der diesjährigen Beiträger: Jayne-Ann Igel, Steffen Popp, Marlen Pelny, Jürgen Becker und Olaf Weber. In Naumburg läuft noch bis 2. November die Landesausstellung von Sachsen-Anhalt zum Naumburger Meister. Wir nutzten den Anlass für ein Interview mit Rosemarie Schuder, die 1928 in Jena geboren wurde und vor 55 Jahren einen Roman über den Meister geschrieben hat, der bis heute ein Bestseller ist, obwohl seine Grundthese noch immer von den Fachhistorikern abgelehnt wird: „Der Ketzer von Naumburg“. Heidemarie Förster-Stahl erinnert an Versuche, Schillers legendäre Katharina von Schwarzburg auf die Bühne zu bringen. Und über die Hintergründe des Palmbaum-Einbandes sprechen wir mit Martin Max aus Weimar.
Besonders umfangreich sind diesmal die Nachrichten aus dem literarischen Leben. Bereits zum vierten Male wurde am 5. Oktober der Thüringer Literaturpreis verliehen. Wir freuen uns, Ihnen nur wenige Tage später mit dem vorliegenden Heft die Laudatio von Michael Hametner und die Dankrede von Jürgen Becker vorlegen zu dürfen.
Es ist wieder ein pralles Heft – mit 238 Seiten in Englischer Broschur eigentlich ein Buch, wie jedes der vergangenen 12 Hefte. Seit 2005 haben wir die Qualität der Zeitschrift merklich gesteigert. Auch die Kosten für Druck und Papier stiegen seitdem. Nicht aber unser Verkaufspreis. Das ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Um die Qualität zu sichern, muss der Verlag nun erstmals auch den Preis erhöhen. Ab Heft 1/2012 kostet das Einzelheft 9,90 EUR. Das Abonnement für zwei Hefte pro Jahr erhöht sich auf 18,00 EUR. Wie bisher ist für Abonnenten innerhalb Deutschlands der Versand inbegriffen.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Heinrich von Kleist
- Beiträge von Jochen Klauß (Goethe und Kleist), Bernd Leistner (Kleist in Dresden), Klaus Bellin: (Kleists Berliner Abendblätter), Jürgen K. Hultenreich, Volker Braun (Tagebuchnotiz), André Schinkel, Horst Peter Meyer.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Martin Max)
- PROSA von Stefan Raile, Kathrin Groß-Striffler, Jan Decker, Grit Bärenwald und Ralf Krüger.
- LYRIK von Annerose Kirchner, Horst Wiegand und Roland Bärwinkel.
- MITTELDEUTSCHE LYRIKNACHT mit Jayne-Ann Igel, Steffen Popp, Marlen Pelny, Jürgen Becker und Olaf Weber.
- SPURENSUCHE zu Dramen über Katharina von Schwarzburg (Heidemarie Förster-Stahl)
- INTERVIEW mit Rosemarie Schuder
- LITERARISCHES LEBEN:
Laudatio (Michael Hametner) und Dankrede zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Jürgen Becker; Glückwünsche für Gottfried Meinhold und Dieter Fechner; Erinnerungen an Wolfgang Hilbig; Ausschreibung Menantes-Preis u.a.m.

Cover mit einer Zeichnung von Horst Sakulowski (Weida)
Heft 52
EDITORIAL
Der Palmbaum versucht, seinen Lesern auch als Nachschlagewerk mit praktischen Themen zu dienen. Nach einem Verzeichnis aller Thüringer Verlage und einer Präsentation der Literaturgedenkstätten im Freistaat haben wir im vergangenen Heft die literarischen Vereine und Gesellschaften im Bundesland vorgestellt. Nun wird es Zeit, wieder einmal ein historisches Titelthema zu bringen: Cornelia Hobohm geht dem Echo nach, das die Legende vom „zweibeweibten Grafen von Gleichen“ in der Literatur gefunden hat und Martin Pfaff schreibt über Goethes Adaption der Sage. Um Liebesdinge kreisen auch die 16 Gedichte und Geschichten, die wir noch vom Menantes-Preis für erotische Dichtung 2010 auf Lager hatten. Sie hätten in die Anthologie zum Wettbewerb gehört, wenn die nicht mit 35 Beiträgen bereits überfüllt gewesen wäre. Übrigens schreiben wir schon jetzt den Wettbewerb für 2012 aus: möge der Sommer Sie auf lustvolle Ideen bringen!
Im Prosa-Block drucken wir fein verwobene Erzählungen von Frauen, die sich auf merkwürdige Weise ergänzen. Dafür stammt die Lyrik diesmal nur von Männern. Der Erfurter Student René Kanzler wagt etwas Seltenes: einen Sonetten-Kranz. Die Gefahr solcher Versuche liegt im Überwiegen des technisch Handwerklichen. Schreiben Sie uns, ob die Form noch zeitgemäß ist.
Froh sind wir, dass Landolf Scherzer die Zeit gefunden hat, uns ein Interview zu geben. Der rastlose Grenzgänger gibt Auskunft über sein Selbstverständnis, soziale Wirklichkeiten von unten zu erkunden, jenseits ideologischer Wunschbilder – in der DDR und heute.
Matthias Biskupek erinnert mit einem Funkessay an den ersten Todestag von Gisela Kraft und zitiert dabei erstmals Passagen aus einer unveröffentlichten Autobiografie der Weimarer Dichterin.
Allein unser Rezensionsteil umfasst diesmal sage und schreibe 27 prall gefüllte Seiten. Für eine kleine regionale Literaturzeitschrift ist das alles andere als normal. Und noch etwas Besonderes: für die Einbandzeichnung konnten wir den Thüringer Altmeister Horst Sakulowski gewinnen. In den Nachrichten gratulieren wir Eberhard Haufe und Edwin Kratschmer zum 80., berichten von einer Thomas-Bernhard-Ehrung in Saalfeld und fragen nach dem Überlebenskampf Thüringer Theater. Lesen Sie zuletzt, was andere Zeitschriften und Zeitungen vom Palmbaum halten.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Liebe und andere Irrtümer
- Cornelia Hobohm über das Echo der Legende vom zweibeweibten Grafen zu Gleichen in der Literatur
- Martin Pfaff über Goethes »Stella«
- 16 erotische Gedichte und Geschichten von Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Horst Sakulowski)
- PROSA von Elisabeth Dommer, Ursula Schütt und Nancy Hünger
- LYRIK von René Kanzler, Lothar Quinkenstein, Lutz Rathenow, Ralph Grüneberger und Peter Gosse (für Karl-Georg Hirsch)
- HÖRSTÜCKE von Matthias Biskupek (über Gisela Kraft) und Michael Ziegler
- SPURENSUCHE zu Kotzebue und Thümmel (Werner Liersch und Sebastian Hennig)
- INTERVIEW mit Landolf Scherzer
- LITERARISCHES LEBEN:
Glückwünsche für Edwin Kratschmer und Eberhard Haufe (beide 80); zur Lage der Theater in Gera-Altenburg sowie Meiningen und Eisenach; Schütt-Fabel im Lessing-Museum u.a.m.
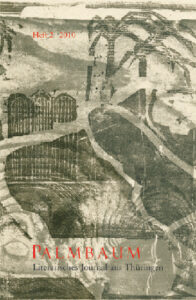
Cover mit Holzschnitt von Stefan Knechtel
Heft 51
EDITORIAL
Der Alltag hat uns wieder eingeholt. Nach dem Jubiläumsheft mit 50 Autoren legen wir Ihnen nun das 51. vor. Diesmal wieder mit einem Titelthema: Literarische Vereine und Gesellschaften aus Thüringen stellen sich vor und werden mit ausgewählten Arbeiten vorgestellt. Ist es doch gerade die Breite und Vielfalt der oft kleinen Vereine, die mit wenig Mitteln, aber viel Fantasie den Reichtum der Thüringer Literaturlandschaft ausmacht.
Wie in jedem Herbst dokumentieren wir die „Mitteldeutsche Lyriknacht“ mit je zwei Gedichten der fünf Beiträger. Im Prosa-Block bringen wir neben einer Geschichte von Hubert Schirneck einen Versuch von Ulrike Blechschmidt, mit den Mitteln des Märchens den Schrecken nahe zu bringen, der uns täglich in den Nachrichten aus Afghanistan erreicht und kaum noch zu berühren vermag.
Ein ungewohntes Licht auf die Mann-Familie wirft das Gespräch von Adelbert Reif mit Katrin Andert über deren Monika-Mann-Biographie. Besonders umfangreich ist diesmal die Literarische Spurensuche mit Beiträgen über Seume, Fritz Reuter und Nietzsche.
Am 12. Juni wurde im Pfarrhof von Wandersleben zum dritten Mal der Menantes-Preis für erotische Dichtung verliehen. 630 Autorinnen und Autoren haben sich um den Preis beworben, den der Menantes-Förderkreis der Evang. Kirchgemeinde Wandersleben mit dem Palmbaum ausgeschrieben hat. Lesen Sie die Texte der fünf Finalisten.
Kulturhauptstadt Europas – mit diesem Titel durfte sich 1999 Weimar schmücken, 11 Jahre später trägt ihn das Ruhrgebiet. Zwei Autorinnen aus Essen und Düsseldorf geben Einblicke in die Alltagskulur dieser Region.
Es ist wieder ein pralles Heft mit vielen Themen geworden, die, so hoffen wir, jedem etwas bieten. Zuletzt noch ein Wort in eigener Sache: An dieser Stelle hatte sich im März der alte Redakteur verabschiedet. Unter den gegebenen Bedingungen war er an die Grenzen des ehrenamtlich Machbaren gestoßen. Ein Ersatz fand sich nicht. Zahlreiche Autoren baten vielmehr, die Arbeit fortzuführen. Eine angemessene Erhöhung der Fördermittel durch das Land Thüringen ermöglicht nun eine größere Konzentration auf die nötige Arbeit. So grüße ich Sie erneut und bitte wie immer um Anregungen und Kritik.
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Literarische Vereine und Gesellschaften in Thüringen
- Präsentation von 22 Vereinen und Gesellschaften, darunter Anna Amalia und Goethe Freundeskreis e.V., Deutsche Shakespeare-Gesellschaft, Freunde des Goethe-Nationalmuseums, Friedrich-Bödecker-Kreis, Goethe-Gesellschaft, Kulkturrausch e.V., Lesezeichen e.V., Literarische Gesellschaft Thüringen e.V., Palmbaum e.V., Südthüringer Literaturverein, Weimart, Wortwuchs u.v.m.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Stefan Knechtel)
- Neue Prosa von Hubert Schirneck, Ulrike Blechschmidt und Jan Decker sowie Mitteldeutsche Lyriknacht mit Andreas Altmann, Carl-Christian Elze, Elke Erb, Dirk von Petersdorff und Katrin Marie Merten.
- SPURENSUCHE zu Seume, Fritz Reuter und Nietzsche (Friedrich Dieckmann und Jens‑F. Dwars)
- REZENSIONEN
- MENANTES-PREIS: die Beiträge der fünf Finalisten.
- LITERARISCHES LEBEN:
Glückwünsche für Wolfgang Held (80), Dertlef Ignasiak und Matthias Biskupek (beide 60).

Cover mit Mischtechnik und Collage von Kay Voigtmann
Heft 50
EDITORIAL
Der Palmbaum wird 50. Nein, keine 50 Jahre alt, aber immerhin erscheint das Journal mit dem vorliegenden Heft zum 50. Mal. Wer die Geschichte literarischer Zeitschriften in Deutschland kennt, der weiß, dass nur wenige das halbe Hundert erreichen, wenn nicht ein zahlungskräftiger Verlag oder eine Akademie dahinter steht.
Der Palmbaum wird seit 1993 von einem kleinen Verein gleichen Namens herausgegeben und erscheint seit 1997 im Kleinverlag seines Begründers Detlef Ignasiak. Keine guten Vorzeichen. Und doch ist der Palmspross gediehen, hat sich ausgewachsen zu einem Bäumchen von stattlicher Größe. Zumindest die letzten zehn Hefte sind mehr, als man von Heften erwarten darf: spannende und spannungsreiche Textsammlungen, die auf 200 und mehr Seiten im Buchformat Beiträge zur reichen Kulturgeschichte des Landes Thüringen mit literarischen Texten von Gegenwartsautoren vereinen und deren Einbände von Thüringer Künstlern gestaltet wurden. Nicht der heimische Tannenbaum ist unser Signet, sondern die Palme, die sich einst der Palmenorden zum Zeichen erwählt hat, die erste Gesellschaft zur Pflege der deutschen Sprache und Literatur, 1617 in Weimar gegründet. In dieser Tradition verwurzelt, wollte die Zeitschrift immer ein offenes Fenster sein: der „Welt“ vom literarischen Treiben in Thüringen zu berichten und umgekehrt die Literatur von draußen in die eigenen Räume zu befördern.
In dem Sinne haben wir fünfzig Palmbaum-Autoren der letzten 49 Hefte gebeten, mit ihren Geschichten aus aller Welt die Jubiläumsausgabe zu bereichern. Entstanden ist ein prall gefülltes Lesebuch aus Gedichten, Kurzerzählungen und Essays, das Ihnen, liebe Leser, hoffentlich genau so großes Vergnügen bereitet, wie der Redaktion.
Wir danken allen, die 50 Hefte ermöglicht haben. Ohne eine einzige „Stelle“ entstanden sie durch das Engagement aller Beteiligten. Wir danken dem Freistaat Thüringen für langjährige Förderungen und zahlreichen Sponsoren für oftmalige Unterstüzung. Ein besonderer Dank gilt der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die uns geholfen hat, dieses schöne Heft zu finanzieren.
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich verabschiede mich daher als Redakteur von den Lesern des Palmbaums, dem ich als Autor verbunden bleibe.
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: 50 Beiträge zum 50.
- Gedichte, Prosa und Essays von Antje Babendererde, Roland Bärwinkel, Wilhelm Bartsch, Zdenka Becker, Matthias Biskupek, Ingo Cesaro, Karl Otto Conrady, Daniela Danz, Jan Decker, Friedrich Dieckmann, Christoph Dieckmann, Hans-Jürgen Döring, Jenny Feuerstein, Moritz Gause, Kathrin Groß-Striffler, Ralph Grüneberger, Wolfgang Haak, Christine Hansmann, Holger Helbig, Wolfgang Held, Nancy Hünger, Reinhard Jirgl, Bernd Kauffmann, Annerose Kirchner, Bärbel Klässner, Peter Krause, Reiner Kunze, Katrin Marie Merten, Peter Neumann, Hans van Ooyen, Stefan Petermann, Richard Pietraß, Uwe Pörksen, Frank Quilitzsch, Lutz Rathenow, Andreas Reimann, Jan Volker Röhnert, Christian Rosenau, Ulrike Almut Sandig, Landolf Scherzer, André Schinkel, Friedrich Schorlemmer, Ursula Schütt, Siegfried Schütt, Ingo Schulze, Lutz Seiler, Martin Straub, Romina Voigt, Harry Weghenkel, Uljana Wolf.
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Kay Voigtmann)
- REZENSIONEN
- LITERARISCHES LEBEN:
Thüringer Literaturtage 2010
Menantes-Preis 2010

Cover mit einer Graphik von Horst Peter Meyer (Weimar)
Heft 49
EDITORIAL
Thüringen ist eine traditionsreiche Literaturlandschaft. Davon zeugen nicht zuletzt große Bibliotheken mit wertvollen Altbeständen. Aber: ein reiches Erbe kann arm machen, denn Erben verpflichtet zum Erhalt des Überkommenen. Auch deshalb mag es kein Zufall sein, dass ausgerechnet Thüringen das erste Bundesland war, dessen Parlament 2008 ein Bibliotheksgesetz beschlossen hat.
Genau ein Jahr später ziehen wir eine erste Bilanz: An der Lage der Bibliotheken hat sich nichts geändert, die Etats drohen eher zu schrumpfen. Welche Bedeutung sie für das geistige Leben nicht nur im Freistaat haben und welche Schätze es zu bewahren gilt, das zeigt das vorliegende Heft: große historische Büchersammlungen in Jena, Gotha, Erfurt, Weimar und Rudolstadt stellen sich vor. Daneben zeigen wir an Beispielen in Sömmerda, Mühlhausen und Greiz, welch unverzichtbaren Beitrag für die Breite und Vielfalt von Alltagskultur kleinere Bibliotheken im Land leisten.
Im Lyrik-Teil verabschieden wir uns von dem jüngst verstorbenen Günter Ullmann mit letzten Gedichten und Aphorismen dieses leisen Poeten. Ein wunderbar verschachtelter Prosa-Text von Jan Decker, Reinhard Jirgls Mitteilungen aus dem „Betriebsleben eines Schriftstellers“ und die Suche nach Spuren von Thomas Bernhard in Saalfeld ergänzen einander – ungeplant – wie Variationen auf ein uraltes Thema: die Nöte des Schreibens, der Zweifel, die der Schreibende in seiner Werkstatt auszutragen hat – das Gegenstück zu den Bibliotheken, in denen die fertigen Resultate scheinbar mühelos ruhen.
Man mag es nicht glauben: ein Schiller-Jahr geht zur Neige. Wir versuchen eine Zwischenbilanz und geben Raum für kritische Überlegungen zum Bauhaus, dessen 90. Geburtstag zumindest in Weimar mehr gefeiert wurde als der 250. des Klassikers.
Im Mai gedachte die Klassik Stiftung des 100. Geburtstages von Louis Fürnberg. Wulf Kirsten, der wenig später seinen 75. Geburtstag beging, hielt eine ungewöhnliche Festrede. Sie finden sie in diesem Heft. Am 5. September wurde der Thüringer Literaturpreis an Reiner Kunze verliehen. Wir freuen uns, die Laudatio von Christian Eger und die Dankrede des Preisträgers dokumentieren zu dürfen.
Kurz: Es ist ein ungemein starkes Heft in jeglichem Sinne. Ein Vorgeschmack auf das kommende, das 50., das im März 2010 erscheinen soll.
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Thüringer Bibliotheken
- Annette Kasper/Gerhard Vogt:
Thüringer Bibliotheken - Die wertvollsten Thüringer Buchsammlungen: ThULB Jena, Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar, Forschungsbibliothek Gotha-Erfurt, Historische Bibliothek Rudolstadt, Goethes Bibliothek.
- Bibliotheksalltag in Greiz, Sömmerda und Mühlhausen
- Frank Simon-Ritz: Erfahrungen mit dem Thüringer Bibliotheksgesetz
- LYRIK (u.a. letzte Gedichte von Günter Ullmann, Ingo Cesaro)
PROSA (Stefan Petermann, Johannes Lange, Jan Decker) - VORTRAG: Reinhard Jirgl und Wulf Kirsten (über Louis Fürnberg)
- SPURENSUCHE: Annelie Morneweg über Thomas Bernhardt in Saalfeld
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Horst Peter Meyer)
- REZENSIONEN
- LITERARISCHES LEBEN:
Thüringer Literaturpreis 2009
an Reiner Kunze
Laudatio von Christian Eger
Dankrede von Reiner Kunze,
Annerose Kirchner über W. Kirsten
Bärbel Klässner zum Herbst 89, Jens‑F. Dwars über Nietzsche

Cover mit einer Graphik von Sabine Sauermilch
Heft 48
EDITORIAL
Lila, sagt der Volksmund, ist die letzte Versuchung. Keine Angst, liebe Leser, wir wollen nicht mit fragwürdigen Mitteln um Ihre Gunst buhlen. Auch wenn eine Thüringer Zeitung meinte, die Existenz der Zeitschrift sei bedroht. Es gab Querelen nach dem Interview mit dem Fast-Kultusminister und damals Noch-Beiratsmitglied der Zeitschrift Peter D. Krause. Der Beirat hat sich danach aufgelöst. Wir dokumentieren Stimmen zu dem Streit.
Die Zeitschrift steht auf sicheren Füßen. Die Zahl ihrer Abonnenten hat sich im vergangenen Jahr um ein Viertel erhöht und wie viele gute Texte uns erreichen, das zeigt der Lyrik-Block in dem vorliegenden Heft. Das Besondere daran: es sind vor allem junge Autorinnen und Autoren, die ihre Gedichte eingesandt haben. Da wir nur zweimal im Jahr erscheinen, hatten sich eine Menge Manuskripte angesammelt. Wir wagen es daher, 30 Seiten Lyrik zu bringen.
Im Prosa-Teil finden Sie zwei Vorabdrucke aus autobiographischen Erzählungen. Albrecht Börner, dem wir zum 80. Geburtstag gratulieren, berichtet über Hintergründe der ostdeutschen Medienlandschaft, die er als Verlagslektor, Fernsehautor und Zeitzeuge der ersten Jahre des MDR mitgestaltet hat. Beeindruckend sind die „unzeitgemäßen Betrachtungen“ von Manfred Gebhardt, des letzten Magazin-Chefredakteurs der DDR, über seinen Vater, der aus Arbeitertugenden zum Nazi wurde.
Unser Titelthema ist diesmal „Fabeln – einst und jetzt“ gewidmet. Der erste Teil war einfach einzulösen: Die Menantes-Gedenkstätte von Wandersleben lädt im Juni zu einer Fabel-Tagung ein. Wir bringen vorab die schönsten Menantes-Fabeln und stellen das Gellert-Museum Hainichen mit seiner Sammlung von Fabel-Illustrationen vor.
Aber Fabeln heute? Tatsächlich sind wir fündig geworden: Zum Beispiel in den Fabeln von Gerhard Branstner, die zwar auf die DDR gemünzt waren, aber mit deren Untergang nicht unbedingt auf den Müll der Geschichte gehören. Wiedergelesen haben wir Fabeln von Gisela Kraft und ein paar Autoren haben für uns und Sie ganz neu fabuliert.
Den Einband hat Sabine Sauermilch aus Erfurt gestaltet – in zartem Violett, für Goethe eine vornehme Farbe, die „einen ganz besonderen Reiz ausübt“. Genießen Sie ihn!
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Fabeln
- Detlef Ignasiak:
Luthers Coburger Äsop - Menantes: Fabel-Übersetzungen
- Angelika Fischer: Das Gellert-Museum Hainichen
- Fabulöse Nachrichten aus der DDR von Gerhard Branstner
- Fabeln von Gisela Kraft, Matthias Biskupek, Harry Weghenkel, Siegfried und Ursula Schütt
- LYRIK (u.a. Roland Bärwinkel, Katrin Merten und Andreas Reimann)
PROSA (Albrecht Börner, Manfred Gebhardt, Heidi Büttner) - DEBATTE: Pro und Contra zum Interview mit Peter D. Krause
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Sabine C. Sauermilch)
REZENSIONEN
NACHRICHTEN (u.a. Programm der Thüringer Literaturtage und der Fabel-Tage in Wandersleben)

Cover mit einer Zeichnung von Gino Hahnemann
Heft 47
EDITORIAL
Von Anfang an, seit Gründung des Palmbaums, hatten wir gehofft, mit der Thüringer Literaturzeitschrift auf das Interesse vieler Lehrer zu stoßen. Immerhin erschließen wir nicht nur das reiche Erbe Thüringer Literatur, sondern vermitteln zugleich Texte heutiger Autoren. Dennoch gehören Lehrer zur kleinsten Berufsgruppe unter den Abonnenten. Also haben wir uns gedacht: Wenn die Schule nicht zu uns kommt, gehen wir in die Schule und befragen die Lehrer: Welche Chancen hat Literatur im Unterricht – ist sie Lust oder Frust? Was bewirken Schullesungen mit Schriftstellern, wie sie der Bödecker-Kreis organisert? Ergänzt werden die Erfahrungsberichte durch zwei konkrete Angebote: eine Modellinterpretation eines Gedichtes von Wulf Kirsten und ein Vorschlag, Goethes Gretchenfrage vor dem Hintergrund seiner Haltung zum Todesurteil über eine Weimarer Kindsmörderin vor genau 225 Jahren zu lesen.
Die VII. Mitteldeutsche Lyrik-Nacht wird die letzte unter der Leitung von Gisela Kraft sein. Noch einmal hat sie verschiedene Stimmen nach Belvedere eingeladen, die unsere Dokumentation vereint.
Die Dankrede von Ingo Schulze zum Thüringer Literaturpreis, die wir vor einem Jahr veröffentlicht haben, hat Langzeitwirkung. Dazu gehört der Streit um einen Beitrag in unserem letzten Heft, der kurz zwischen der „Süddeutschen“ und der F.A.Z. aufgeflammt ist, ebenso wie das „Harald-Gerlach-Stipendium“, das erstmals für 2009 ausgeschrieben wird. Lesen Sie mehr dazu unter Palmbaum-Debatte.
Im Mai wurde Peter D. Krause vom Thüringer Ministerpräsidenten zum Kultusminister berufen. Nach heftiger Auseinandersetzung in den Medien trat er zurück. Wir fragen ihn nach den Gründen.
Der Einband des vorliegenden Heftes ist wieder nach dem Bild eines Thüringer Künstlers gestaltet, doch diesmal ausnahmsweise nach der Fotografie eines bereits verstorbenen: Gino Hahnemann (1946–2006) wurde in Jena geboren, hat in Weimar studiert, aber danach in Berlin gelebt. Für seinen Nachlass wird jetzt ein Archiv in der Berliner Akademie der Künste eröffnet. Zuvor finden am 17./18. Oktober in Weimar Gino-Hahnemann-Werktage statt. Für uns ein Anlass, an diesen vielseitigen Künstler zu erinnern.
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Literatur in der Schule
- Erfahrungsberichte von Lehrern und Autoren, u.a. »Romeo und Julia in der Regelschule« von Cornelia Hobohm
- Interpretationsangebote für den Schulunterricht, u.a. zur Frage: War Goethe schizophren, wenn er im »Faust« eine Kindsmörderin verteidigt und in Weimar 1783 ein Gretchen hinrichten ließ?
- VII. Mitteldeutsche Lyriknacht (u.a. mit Wahid Nader, Ulrike Almut Sandig, Holger Uske und Richard Pietraß)
- PROSA (Jan Decker, Kathrin Groß-Striffler, Stefan Schütz)
- INTERVIEW mit Peter D. Krause
- DEBATTE: Die Folgen der Dankrede von Ingo Schulze zum Thüringer Literaturpreis
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Texte von und über Gino Hahnemann zur Einrichtung des Hahnemann-Archivs in der Akademie der Künste, u.a. mit der Grabrede von Gerhard Wolf)
- Die Beiträge der fünf Finalisten zum Menantes-Preis für erotische Dichtung
- REZENSIONEN
NACHRICHTEN (u.a. Dankrede von Dietmar Ebert zum Caroline-Preis)
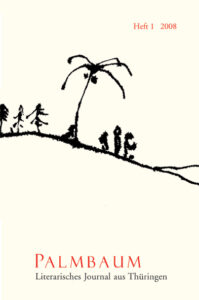
Cover mit einer Zeichnung von Walter Sachs (Weimar)
Heft 46
EDITORIAL
Jena leuchtet, unter diesem Slogan begann die „Stadt der Wissen schaft 2008“ das Jahr des 450. Gründungsjubiläums ihrer Universität am 2. Februar mit einem Feuerwerk aus Licht: an fünf Orten proji zierten Lichtdesigner virtuelle Bilder auf Häuserwände und auf dem Campus gab es eine gigantische Lasershow mit Elektrosound und Live-Drums. Anders als in Anglizismen kann man das Megaevent kaum fassen, von dem es Tags darauf in allen Medien hieß, 80.000 Menschen habe es auf die Straßen gelockt. Jena, triumphiert eine Website, sei das „München des Ostens“, ein Studentenparadies: „jena ist der hammer, / jena ist geil, / jena ist spitze // und jena leuchtet immer“, jubelt ein Blog-User in fast schon lyrischem Hochgesang. Und die Kosten des Spaßes? 100.000 EUR – das entspricht in etwa der Summe, die das Thüringer Kultusministerium 2008 zur Förderung von Literatur im gesamten Land ausgeben wird. Ein Jahresbudget – verfeuert an einem Abend zum Lichtbehagen der Leute.
Nein, ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wer seinen Spaß daran hat, über das Farbenspiel am nächtlichen Himmel zu staunen, im Gewühle der Massen stundenlang hinauf zu glotzen, das zuckende Geflecht der Laserstrahlen mit Minidigitalkameras ein zufangen, die am nächsten Morgen nur noch verwackelte Lichttupfer erahnen lassen, dem sei dies alles von Herzen gegönnt. Es ist gewiss klug und touristisch vonnöten, an solch zeitgemäßen Jubelfeiern nicht zu sparen. Ich wünschte mir nur manchmal, die Planer und Finanziers dieser Feste würden zuweilen auch eine unzeitgemäße Wahrheit bedenken: „Was bleibet aber, das stiften die Dichter“, schrieb Hölderlin, ein zu Lebzeiten Vergessener, dem wir heute die schönsten Verse deutscher Sprache verdanken. In dem Sinne wird der Palmbaum auch weiterhin versuchen, über die Selbstfeier der Gegenwart das Bleibende nicht aus dem Auge zu verlieren, das einst Geschaffene wie hier und heute neu Entstehendes.
Um dies auf einer breiteren Basis zu leisten, wird die Zeitschrift fortan in Zusammenarbeit mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. herausgegeben. Das vorliegende Heft ist der hiesigen Verlagslandschaft gewidmet, das nächste fragt nach „Literatur in der Schule– Lust oder Frust?“
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Thüringer Verlage
- Präsentation von 42 Verlagen
- Detlef Ignasiak: Thüringer Verlagsgeschichte seit der Reformation
- Carsten Wurm: Der Greifenverlag zu Rudolstadt
- Jens Kirsten: Der Gebrüder Knabe Verlag
- Jens-Fietje Dwars: Meisterbücher aus der Cranach Presse Weimar
- Helge Pfannenschmidt: Lust und Leid kleiner Verlage
- LYRIK (u.a. von Annerose Kirchner, Maik Lippert und Edgar Leidel)
PROSA (Wolfgang Haak, Christine Hansmann und Ursula Martin) - INTERVIEW zum Thüringer Literaturat
- DEBATTE: Walter Bauer-Wabnegg antwortet auf die Dankrede von Ingo Schulze zum Thüringer Literaturpreis
- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Walter Sachs)
REZENSIONEN
NACHRICHTEN (u.a. Programm der Thüringer Literaturtage und Ausschreibung Stadtschreiber von Ranis)

Cover mit einer Zeichnung von Gerd Mackensen
Heft 45
EDITORIAL
Das Netzwerk literarischer Orte nachzuzeichnen, das die Thüringer Landschaft wie kaum eine andere mit ungeheurer Dichte über Jahrhunderte hinweg durchzieht, hatten wir im letzten Heft für das nächste, also das nun vorliegende angekündigt. Dass es nicht, wie gewohnt, im Oktober, sondern erst Ende November erscheint, hat zwei Gründe: Wir wollten ein Verzeichnis aller Literaturgedenkstätten des Landes erstellen, eine Art Reiseführer durchs kulturelle Thüringen. Drei Monate gaben wir den Museen für die Beantwortung unserer Fragen, und doch kamen die letzten buchstäblichen in der letzten Minute vor Fertigstellung des Druckmanuskripts an. Und das nicht aus Desinteresse, haben doch die meisten, die kleinen Museen eine solche Werbung nötiger denn je. Sie aber trifft die dramatische Finanzlage am stärksten: der Personalbestand wird bis zur Schmerzgrenze reduziert, die Etats reichen kaum zum Erhalt der musealen Objekte, von Neuerwerbungen oder Sonderausstellungen zu schweigen. Genau darüber wollten wir reden. In einem Augenblick, da alle nur von der Rettung der Thüringer Theater sprechen, denen wir bereits vor zwei Jahren ein Heft gewidmet haben, nehmen wir die Museen und Gedenkstätten in den Blick, deren ungleich schwierigere Situation in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt, obwohl sie weit mehr Besucher ins Land locken und dauerhafte Impulse verleihen.
Der zweite Grund ist dem ersten verwandt: Anfang November erhielt Ingo Schulze den Thüringer Literaturpreis. Da wir dem Lesepublikum die Reden des Preisträgers und des Laudators nicht vorenthalten wollten, mussten wir darauf warten. Und wurden reich belohnt: Thomas Steinfeld, der Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, hielt eine selbst preiswürdige Rede, die dem teuflisch Eigenwilligen der hiesigen Kulturlandschaft, dem Hintergründigen gewidmet war, aus dem Schulzes Werk zu begreifen wäre. Und der Ausgezeichnete ging noch einen Schritt weiter, mitten in die Abgründe des Hier und Jetzt hinein: Er machte den Widerspruch fühlbar, dass das Land den Preis nicht bezahlt, nach dem er benannt ist, warnte vor einer Refeudalisierung der Kultur, wenn sie sich dem Sponsoring ausliefert, und stiftete das Preisgeld für ein Literaturstipendium. Ein Beitrag zu unserer Debatte: Welche Kultur wollen wir – um welchen Preis?
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Literarische Orte
- Gesamtpräsentation aller Thüringer Literaturgedenkstätten auf über 70 Seiten – ein Reiseführer durch die Kulturlandschaft des Freistaates
- Holger Nowak: Zur Lage der Thüringer Museen
- Michael Ludscheidt: Kaspar Stieler
- Eckhard Ullrich: Friedrich Melchior Grimm in Gotha
- Heinz Stade: Dichterstätte Sarah Kirsch in Limlingerode
- Udo Scheer: Der Jenaer Arbeitskreis Literatur
- LYRIK (u.a. von Andreas Reimann, Steffen Mensching, Lutz Rathenow, Nancy Hünger, Ralf Meyer und Uwe Lammla)
PROSA (Antje Babendererde, Roswitha Spangenberg und Anne Kneip)
SPURENSUCHE (zur heiligen und unheiligen Elisabeth, u.a. mit Sylvia Weigelt und Kai Agthe)
AKTUELLES (Laudatio von Thomas Steinfeld auf Ingo Schulze und dessen streitbare Dankrede für den Thüringer Literaturpreis)
PALMBAUM-UMSCHLAG (Begegnung mit Gerd Mackensen)
REZENSIONEN
NACHRICHTEN (u.a. Ausschreibung des Wettbewerbs um den Menantes-Preis für erotische Dichtung 2008)
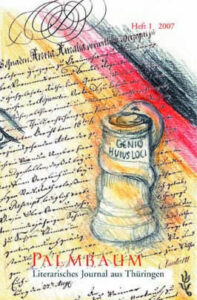
Cover mit einer Graphik von Heinz Georg Häußler
Heft 44
EDITORIAL
Weimarzentrismus – so lautet ein beliebter Vorwurf gegen alles, was aus Weimar oder dessen Umfeld kommt. Wie die Literarische Gesellschaft, die an der Ilm ihren Sitz hat, oder der Palmbaum, der im Nachbartal wurzelt. Natürlich nervt es auf die Dauer, wenn ein Ort seit 200 Jahren behauptet, die Literaturhauptstadt der Deutschen zu sein und dabei permanent mit alten Karten spielt.
Als sei Alter an sich schon ein Wert. Oder geht es um etwas anderes? Was zieht die Leute wieder und wieder in diese Stadt? Die Sehnsucht nach einer verlorenen Harmonie? Die es niemals gab in diesem Musendorf, wo man um 1800 noch Kühe durch die Gassen trieb, wo ländliche Armut mit kulturell ambitionierter Hofhaltung Hand in Hand ging. Weimar, das heißt „ideell“, immer wieder über die Grenzen des Bestehenden hinaus zu drängen. Und Weimar heißt auch, reell, immer wieder mit hochfliegenden Plänen Schiffbruch zu landen, eingeholt zu werden vom „durchaus Scheißigen“ der irdischen Verhältnisse, wie es Goethe in seinen jüngeren Jahren auf den Punkt zu bringen pflegte.
Die folgenden Beiträge bewegen sich zwischen den Polen des ideellen und des realen Weimar. Sie laden zu erneuter Sicht auf scheinbar Altbekanntes ein und wollen Neugier auf das kommende Weimar wecken, das sich im Hier und Heute wandeln muss. Dass dieser Wandel sich nur im politischen Raum vollziehen kann, haben die vergangenen Monate seit dem letzten Heft deutlich gemacht. Die Diskussionen um die Finanzierung des Kulturstandortes Thüringen, und darüber hinaus die Verfassungs-Debatte um Kultur als „Pflichtaufgabe“ des Staates generell, halten unvermindert an. Der Palmbaum hat in Heft 2/06 mit einem Essay von Peter D. Krause zum inhaltlichen Streit aufgerufen: Welche Kultur wollen wir um welchen Preis? Im vorliegenden Heft stehen erste Erwiderungen. Mögen sie den nötigen Widerspruch provozieren.
Das nächste Mal wollen wir das Netzwerk literarischer Ort nachzeichnen, das die Thüringer Landschaft wie kaum eine andere mit ungeheurer Dichte über Jahrhunderte hinweg durchzieht. Weimar wird dann wieder nur ein Punkt unter vielen sein…
…
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Mythos Weimar
- Detlef Ignasiaks: Weimars poetische Anfänge·
- Klassiktrio? Für und Wider zu einer These um Anna Amalia und Goethe – mit Beiträgen von Joachim Berger, Jörg Drews, Matthias Huth, Ilse Nagelschmidt, Dan Farelly und Ettore Ghibellino
- Steffen Dietzsch: Das Nietzsche-Archiv und die Juden
- Olaf Nenninger: Das Kunstfest Weimar·
- Gisela Kraft: Dankrede zum Weimar-Preis·
- Bernd Kauffmann: Der Mythos unterm Palmbaum
- LYRIK (Weimar-Gedichte von Ralph Grüneberger, Andreas Reimann, Gerald Höfer, André Schinkel, Wulf Kirsten, Wilhelm Bartsch, Nancy Hünger, Gisela Kraft und beate Bohn)
PROSA (Jürgen Hultenreich und Ursula Schütt)
INTERVIEW (Kai Agthe mit Manfred Gebhardt)
SPURENSUCHE (Ulrich Kaufmann und Klaus Conermann)
AKTUELLES (Antworten von Matthias Biskupek und Luc Jochimsen auf Peter D. Krauses Essay über „Rhetorische Kultur“)
PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Heinz Georg Häußler)
REZENSIONEN
NACHRICHTEN (10. Thüringer Literaturtage auf Burg Ranis, Aufruf zur Gründung einer Thüringen-Bibliothek)
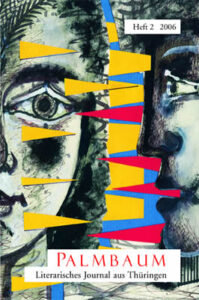
Cover mit einer Graphik von Dieter Weidenbach (Weimar)
Heft 43
EDITORIAL
Aller guten Dinge sind drei. Das dritte Heft in neuem Gewand liegt vor, die Richtung ist absehbar, in die sich der Palmbaum entwickelt. Diesmal geht es um „Literatur im Krieg“ – dem 200. Jahrestag der Schlacht bei Jena und Auerstedt als Anlass verpflichtet, doch weit darüber hinaus greifend. Denn wir leben auch 16 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges nicht in einer friedlichen Welt. „Kein Tag ohne Krieg“ titelte die FAZ am 30. März 2006 und hat sie aufgezählt, die Konflikte seit 1945, bis hin zum Krieg um das rohstoffreiche Kongo, dem 1996–2003 vier Millionen Menschen zum Opfer fielen. Terror heißt eine neue Form von Krieg und selbst US-Geheimberichte geste hen ein, was jeder sehen kann: der weltweite Krieg gegen den Terror hat die Gefahr nicht gebannt, sondern nur verstärkt. 3 000 starben in den Trümmern des World Trade Centers, 70 000 im Feldzug gegen den Irak. Gewalt gebiert neue Gewalt, Hass bricht auf, Brandherde wuchern metastasenhaft. Die Militärhaushalte wachsen, die Bildungs und Kulturetats schrumpfen, der Kampf um die Ressourcen beginnt.
Andererseits: Krieg ist der Vater aller Dinge, hieß es bei Heraklit. Und Hegel sprach von der Einheit der Gegensätze, vom Kampf um Anerkennung als der Triebkraft aller Kultur. Das vorliegende Heft verfolgt die vielen Gesichter des Krieges, seine Sprachwerdung, vom Ringen um Worte inmitten der Gewalt 1806 bis hin zum kaum noch wahrgenommenen Krieg der Sprachen heute, der Zersetzung nahezu aller Nationalsprachen durch Anglizismen im Zuge der Globalisierung. Ist Frankreichs Sprachpolitik ein tauglicher, gar nachahmens werter Versuch, die eigene Identität zu wahren?
Auch das Ringen um die Landesförderung für Thüringer Theater und Orchester, die um 12 Millionen EUR gekürzt werden soll, ist für nicht wenige Kultureinrichtungen ein Kampf um Sein oder Nicht sein. Peter D. Krause hinterfragt den Streit grundsätzlich. Weitere Themen des Heftes sind die V. Mitteldeutsche Lyriknacht und das Finale um den Menantes-Preis für erotische Dichtung, um den sich 770 Autorinnen und Autoren aus dem gesamten deutsch sprachigen Raum beworben haben.
Übrigens: das nächste Mal geht es um den Mythos Weimar …
Jens-Fietje Dwars
TITELTHEMA: Literatur im Krieg
- Vom Krieg sprechen. Das Exempel 1806
- Friedrich Schorlemmer: Das Feld der Ehre und die Ährenfelder
- Der Kummer verzehrt mich ganz. Briefe von und an GoetheJ.
- C.L. Grieser: Schauervolle Rückerinnerung
- Krieger wider Willen. Pfarrer Putsche
- Heinrich von Kleist: Anekdote aus dem letzten Kriege
- Gundula Sell: Nachts auf den Feldern bei Jena und Auerstedt
- Liane Bosse: Verlassener LeibMartin Straub: Die Doppelschlacht 1996
- Elisabeth Garbe: Begegnungen mit Erika Schirmer
- Frédéric Meynier-Heydenreich: Der Krieg der Sprachen
- LYRIK (Bärbel Klässner, René Schinkel, Brigitte Rost, Holger Uske, Felicitas Kretschmann), PROSA (Wolf Zank, Gerald Höfer, Landolf Scherzer, Frank Quilitzsch), INTERVIEW (Kai Agthe mit Gisela Kraft), MITTELDEUTSCHE LYRIKNACHT (Dirk Rose, Marius Koity, Uljana Wolf, Dieter Mucke, Lutz Seiler), SPURENSUCHE (Schillers heldenmütige Katharina), AKTUELLES (Matthias Biskupek über den PEN, Peter D. Krause über „Rhetorische Kultur“), PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Dieter Weidenbach), REZENSIONEN, MENANTES-PREIS FÜR EROTISCHE DICHTUNG (Zdenka Becker, Georg Berger, Xóchil A, Schütz, Daniel Mylow, Ralph Grüneberger), NACHRICHTEN (Thomas Spaniel: 15 Jahre Literarische Gesellschaft Thüringen e.V., Breitbach-Preis an Wulf Kirsten, Reaktionen Thüringer Theater, Nachruf auf Helmut Brandt)
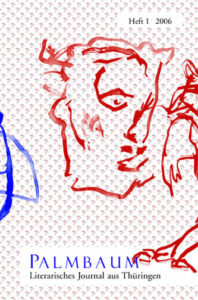
Cover mit einer Graphik von Ullrich Panndorf
Heft 42
EDITORIAL
Der Neuanfang ist geschafft: die 500 Exemplare der letzten Nummer zum Abschluss des vergangenen Jahres waren nach drei Wochen restlos vergriffen. 500 – das klingt nicht viel, aber für eine Literaturzeitschrift, zumal mit regionalem Bezug, war das schon keine geringe Auflage. Wir wollen sie, beginnend mit diesem Heft, Stück für Stück erhöhen, und zählen dabei auf Sie – die Leser und Abonnenten der Zeitschrift.
Natürlich können wir Ihnen nicht immer ein Theaterjahrbuch bieten, wie beim letzten Mal. Thüringen hat 2006 zum „Deutsch-Französischen Jahr“ erklärt. Auch wir werden im Herbst des 200. Jahrestages der Schlacht bei Jena-Auerstedt gedenken. Mit einem Heft über „Literatur im Krieg“. Was geschieht mit der Sprache in den Bedrängnissen des Krieges, der viele Gesichter hat, auch in unserer eigenen Gegenwart … Solche Fragen tauchen auf, wenn man sich der vielfach gebrochenen Lyrik von Michel Deguy nähert, die wir im vorliegenden Heft in Übersetzungen von Jan Volker Röhnert bringen.
Davor stehen zunächst deutsch-französische Spiegelungen im Prisma Thüringer Literaturgeschichte. Olaf Simons zeigt uns im zweiten Teil seines Menantes-Porträts einen Meister „galanter Conduite“, der in seinen Romanen um 1700 französische Lebens- und Erzählweise an deutsche Orte „übersetzt“ hat. Ein Beitrag über Madame de Staël erinnert daran, wie Paris 100 Jahre später auf Deutschland und die Geister von Weimar sah. Die Antwort, die Heine darauf gab, spiegeln wir noch einmal – in einem Gedicht von Harald Gerlach.
Im Prosa-Block gibt es einen neuen, dichten Text der Döblin-Preisträgerin Kathrin Groß-Striffler und nach langen Jahren wieder eine Erzählung von Günther Rücker: das Grauen des vergangenen Jahrhunderts in einer unscheinbaren Geschichte lakonisch umfassend.
Ebenso vielschichtig: ein Gespräch mit dem Berliner Publizisten Friedrich Dieckmann. Auf das beeindruckende Lebenswerk von Eberhard Haufe blickt Wulf Kirsten zum 75. Geburtstag des Editors zurück. Und wer mehr über die Geheimnisse des Einbandes erfahren will, der sei auf das Gespräch mit dem Maler und Grafiker Ullrich Panndorf verwiesen, dessen Zeichnungen das vorliegende Heft umhüllen.
Jens‑F. Dwars
TITELTHEMA: Deutsch-französische Spiegelungen
- Olaf Simons: Menantes. Ein Meister der galanten Conduite
- Olaf Müller: Madame de Staëls Briefwechsel
- Anne Germaine de Staël: Über Deutschland
- Ulrich Kaufmann: Ein Heine-Gedicht von Harald Gerlach
- Heinrich Heine: Über die Deutschen
LYRIK (Michel Deguy), PROSA (Günther Rücker: Eine Böhmische Geschichte), INTERVIEW (mit Friedrich Dieckmann), SPURENSUCHE (Max Bense in Thüringen), AKTUELLES (Journalistenleben in Simbabwe), REZENSIONEN, NACHRICHTEN (Wulf Kirsten: Laudatio Eberhard Haufe; Uwe Pörksen: Ein Brief; Kai Agthe: 15 Jahre Literarische Gesellschaft Thüringen e.V.)

Cover mit einer Zeichnung von Andreas Berner (Wurzbach)
Heft 41
EDITORIAL
Der »Palmbaum« lebt. Auch sein dreizehntes Jahr hat er, allen Unkenrufen zum Trotz, überstanden. Mit einigen Blessuren, aber am Ende doch tapfer und, wie wir hoffen, zu Ihrer Freude. Mit dem Rotstift eine Zeitschrift zu machen, ist Mühsal und kein Geschäft. Aber eine lohnende Aufgabe, solange es Leser gibt, die ihr die Treue halten. Lange mussten Sie auf das erste Doppelheft des Jahres warten, das zweite folgt nun zum Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass der neue Einband Sie versöhnt und Neugier auf das kommende weckt. Denn wir wollen nicht nur weitermachen, sondern einen Neubeginn wagen.
Künftig sollen zwei Hefte im Jahr erscheinen – pünktlich zur Leipziger und Frankfurter Buchmesse im März und Oktober. Jeder Einband dabei von einem anderen Thüringer Grafiker gestaltet. Diesmal von Andreas Berner. Titel und Heftzählung bleiben als wiedererkennbare Bausteine erhalten, doch die Palme wird dem freien Spiel der Phantasie überlassen. Ein Zeichen auch der stärkeren Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Vereinen des Landes. Dazu zählt die Literarische Gesellschaft Thüringen e.V., die uns in diesem Heft ermöglicht, die Mitteldeutsche Lyriknacht und die Reden zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Sigrid Damm in Auszügen zu dokumentieren.
Das Titelthema aber ist der Theaterlandschaft Thüringen gewidmet. Einer außerordentlich reichen und zugleich armen, von immer größeren Sparzwängen bedrohten Landschaft. Mit einer kleinen Bestandsaufnahme möchten wir den Lesern einen Überblick ermöglichen und zeigen, was es zu erhalten gilt. Wir haben daher alle Thüringer Theater gebeten, sich selbst anhand eines Fragenkataloges vorzustellen, der ein Problemfeld umreißen sollte, ohne Schema zu sein. Die Antworten sind so verschieden wie die Befragten. Dazu noch die Eindrücke von Theaterkritikern – und fertig ist das Puzzle, aus dem Sie sich nun Ihr eigenes Bild machen können.
Der Begründer der Zeitschrift, Detlef Ignasiak, ist jetzt ihr Herausgeber. Die Redaktion hat Jens-Fietje Dwars übernommen, in dessen Händen bereits die letzten zwei Hefte lagen. Ein Beirat mit gewichtigen Thüringer Autoren soll für mehr Kontinuität sorgen. Und Sie? Schreiben Sie uns Ihre Kritiken und Vorschläge! Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr!
Titelthema: Theaterlandschaft Thüringen (D. Ignasiak, M. Schubarth, U. Kaufmann, H. Förster-Stahl, D. Fechner, H. Goldberg, F. Qulitzsch, W. Hirsch, M. Günther
- Prosa: Matthias Biskupek, Franziska Wilhelm, Wolfgang Haak
- Lyrik: VI: Mitteldeutsche Lyriknacht mit Gundula Sell, Holger Helbig, Jörg Kowalski, Wulf Kirsten, Andreas Reimann, Gisela Kraft, Nancy Hünger sowie Nachlaßgedichte von Harald Gerlach
- Interview: Andreas Berner/Grafiker (K. Agthe)
- Thüringer Literaturpreis an Sigrid Damm (K. Bellin, H.O. Conrady)
- Städte: Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Hildburghausen, Jena, Meiningen, Mühlhausen, Nordhausen, Rudolstadt, Weimar

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 40
EDITORIAL
Der 200. Todestag von Friedrich Schiller am 9. Mai war das herausragende literarische Jubiläum des Jahres. Mit einer Schiller-Ausstellung in der Jenaer Goethe Galerie, dem größten Einkaufszentrum der Stadt, hat auch unsere Gesellschaft ihren Beitrag zu dieser Dichterehrung geleistet. Zum vielfältigen Rahmenprogramm der Ausstellung gehörten tägliche Diskussionsrunden über Schillers Erbe im Hier und Heute. Die lebendigste geben wir in diesem Heft wieder: ein Gespräch über Kultursponsoring in Zeiten knapper Haushalte mit namhaften Vertretern der Jenaer Kultur- und Wirtschaftsszene.
Weitere Aktivitäten des Palmbaum e. V. galten in diesem Jahr der Wiederentdeckung eines weithin vergessenen Dichters, für den sich dessen Geburtsort, das bei Gotha liegende Dorf Wandersleben, mit beispielhaftem Engagement eingesetzt hat: Christian Friedrich Hunold alias Menantes. Der einst viel gelesene Autor des Spätbarock stand auch im Zentrum einer wissenschaftlichen Konferenz des Palmbaum, die am 16. und 17. September in Wandersieben stattfand. Tagungsort war ein ehemaliges Stallgebäude auf dem Pfarrhof, in dem nach aufwendiger Sanierung unter Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus eine Menantes-Literaturgedenkstätte eröffnet wurde, deren Besuch allen Literaturfreunden zu empfehlen ist.
Gelegenheit dazu bietet unsere diesjährige Jahreshauptversammlung des Palmbaum e.V., die am Sonnabend, dem 12. November 2005 ab 10:00 Uhr in der neuen Gedenkstätte tagen wird. Auf dieser Zusammenkunft soll es auch um die Zukunft unserer Zeitschrift gehen, wird es doch mit leeren Kassen immer schwerer, ein solches Unternehmen am Leben zu erhalten. Aber noch immer ist unser Idealismus groß genug, um an weitere dreizehn Jahrgänge des Palmbaum zu glauben. Das vorliegende Heft, auf das Sie so lange warten mussten, ist das vierzigste: Im Angesicht wachsender Nöte ein Grund zum Feiern!
Titelthema: Menantes. Dichter zwischen Barock und Aufklärung (O. Simons, C. Hobohm)
- Prosa: Wilhelm Bartsch, Franziska Wilhelm, Kathrin Groß-Striffler
- Lyrik: Stefan Schütz, Astrid Schleinitz
- Interview: Sigrid Damm/Schriftstellerin (U. Kaufmann)
- Autoren der Gegenwart: Wolfgang Held (F. Quilitzsch)
- Literaturgeschichte: Friedrich Schiller (J.-F. Dwars, U. Kaufmann), Thomas Mann (G. Schmidt)
- Städte: Gotha, Jena, Weimar

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 39
EDITORIAL
Der Brand der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek hat Tausende Bücher vernichtet, hat Thüringen ärmer gemacht, um einen Teil seiner Geschichte beraubt. Viel wurde gespendet, um beschädigte Bücher restaurieren zu können und verlorene durch Kauf zu ersetzen. Unter den Geldgebern sind nicht wenige, die durch das schlimme Ereignis erstmals von den Schätzen dieser Büchersammlung erfahren haben. Es gibt also doch noch Kulturbewusstsein. So wie viele sich für den Erhalt von Kirchen einsetzen, ohne der Kirche als Institution anzugehören. Viel Geld ist in den letzten Wochen nach Weimar geflossen, das an anderen Stellen fehlen wird, auch und vor allem bei Kultureinrichtungen, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen. So ist zu befürchten, dass dem Bibliotheksbrand viele kleine Brände anderenorts gefolgt sind und noch folgen werden. Doch Kultur braucht Geld genauso wie einzelne Initiativen. Da sie aus vielen Richtungen kommt und viele Interessen bedient, hat sie eine Art demokratischen Unterbau; da sie aber nicht massenbestimmend ist, auch etwas Elitäres. Davon muss man wissen, wenn man Gelder verteilt. Demokratisches Vorgehen nach dem Vorbild televisionärer »Einschaltquoten« wäre das Ende von Kultur. Die oft beschworenen Bürgertugenden sind mehr denn je gefragt und vor allem Phantasie, um wirklich neue Wege zu gehen. Was man von unten bewirken kann, das zeigt das beispielhafte Engagement der Bewohner von Wandersleben, die in Zeiten, in denen eine Kulturstadt Europas Museen schließt, den Aufbau einer neuen Literaturgedenkstätte in ihrem Ort ermöglichen. Auch der Palmbaum versucht, etwas zu bewegen. Dass die Zeitschrift, ohne öffentliche Fördermittel, überhaupt noch existiert, grenzt schon an ein Wunder. Das vorliegende Heft dokumentiert u. a. unseren Vorschlag für ein Goethedenkmal in Jena und die Planungen für eine Schillerausstellung im größten Kaufhaus der Saalestadt. Auf vielfältige Weise wird der Klassiker im nächsten Jahr gefeiert. Doch sollte man sich dabei nicht verausgaben: 2009 ist wieder ein Schiller-Jahr – aus Anlass seines 250. Geburtstages.
Titel: Dichter-Denkmäler (D. Ignasiak, J.-F. Dwars, F. Lindner, K. Agthe)
- Mit dem Entwurf eines Goethe-Denkmals von Heinz Georg Häußler
- Prosa: Gisela Kraft
- Lyrik: Annerose Kirchner, Harald Gerlach, Marius Koity, Manfred Ostückenburg, Holger Uske, Günter Ullmann
- Essay: Renate Hoffmann, Matthias Biskupek
- Interview: Günther Wirth/Literaturwissenschaftler (K. Agthe)
- Literaturgeschichte: Meister Eckhart (F. Lindner), Menantes/Nikolaus von Zinzendorf (A. Schumann), Friedrich Schiller (U. Kaufmann, G. Schmidt, K. Bellin, P. Kösling), Herman Anders Krüger (G. Wirth), Stefan Andres (M. Schmid), Edwin Redslob (H. Förster-Stahl)
- Städte: Gotha, Jena, Rudolstadt, Tambach-Dietharz, Waltershausen, Weimar

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 38
EDITORIAL
»Hier finde ich / die alten Zeichen wieder, / die blaue Farbe des Windes, / gelbgefleckt ein paar Feldwege, / die Weinstraße schattenlos. // Kein anderer Ort / hat diese helle Stimme, / der Muschelkalk im Berg, / halb weiß, / streicht waagerecht aus. // Die Taube / wirbt um deinen Mund. // Unter dem Sonnendach einer Esche / bleibe ich stehen, / getroffen von einem Tag, / der keine Lüge kennt..« Diese eindringlichen Verse schrieb Hanns Cibulka Ende der sechziger Jahre, als er Dornburg besucht hatte. 1972 ließ er ein Tagebuch unter dem Titel »Dornburger Blätter« erscheinen. Auch darin hat die Landschaft einen bestimmenden Platz. Er sprach darin aber auch von der Angst, lange bevor solche Fühligkeit Mode wurde, die beschriebene Schönheit könne nicht bewahrt werden. Diesem Thema ist er bis zum Schluss treu geblieben. Am 21. Juni 2004 ist der Dichter, dreiundachtzigjährig, in Gotha, wo er seit 1952 gelebt hatte, gestorben. Thüringen hat nun eine poetische Stimme weniger, die außerhalb seiner Grenzen gehört wird. Als Wulf Kirsten 1996 ein Thüringer Gedicht-Buch herausbrachte, stellte er das eingangs zitierte Cibulkasche Dornburg-Gedicht an den Anfang. Vor wenigen Wochen ließ der Weimarer Dichter eine weitere Thüringen-Anthologie folgen. Standen in der ersten Sammlung Texte aus den letzten dreißig Jahren, so reichte er jetzt das Vorangegangene nach. Kirsten hat sich damit nicht nur selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk überreicht. Zu seinem 70. Geburtstag, den wir zum Anlass nehmen, den Dichter zu würdigen, hat er uns allen ein Stück Erinnerung geschenkt.
Während der Korrektur erreichte uns eine erschütternde Nachricht aus Weimar: Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek wurde am Abend des 2. September durch einen Brand schwer beschädigt. 40.000 Bücher haben Schäden erlitten, ein Teil davon wird für immer verloren sein. Das Gebäude muss wieder aufgebaut, die Bücher, so weit dies geht, restauriert werden. Das kostet viel Geld. Spendenkonto: Stiftung Weimarer Klassik / Wiederaufbau HAAB, Dresdner Bank Weimar, Kto.: 0932 0230 00, BLZ: 820 510 00
Titel: Zum 70. Geburtstag von Wulf Kirsten (A. Degenkolb, K. Agthe)
- Prosa: Wulf Kirsten
- Lyrik: Jan Volker Röhnert, Gisela Kraft, Michael Wüstefeld, Johanna Lüdde, Daniela Danz, Hans Arnfried Astel, Kito Lorenz, Liane Bosse, Kai Agthe, Dirk Rose, Jenny Feuerstein, Juliane Blech
- Essay: Volker Müller, Jens-Fietje Dwars
- Literaturgeschichte: Herman Anders Krüger (K. Agthe)
- Germanistikgeschichte: Ferdinand Hand (G. Schmidt)
- Städte: Gotha, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 37
EDITORIAL
Von den Weimarer Klassikern ist Johann Gottfried Herder, dessen 200. Todestag in diesen Tagen gedacht wurde, vielleicht der schwierigste. Wenn es um Völkerverständigung und Friedenssehnsucht geht, wird er zwar immer wieder genannt, gelesen wird er aber kaum noch. Dabei stünde es unseren Eliten gut an, ihn hin und wieder mal zu zitieren. Die allgemeine Bildungsmisere lässt eine solche Forderung als einen frommen Wunsch erscheinen. Im ostpreußischen Mohrungen, Her-ders Geburtsort (dem heutigen masurischen/polnischen Morag), wo es seit einigen Jahren im Dohnaischen Schloss ein Herder-Museum gibt, auch ein Denkmal und eine nach ihm benannte Straße (das Geburtshaus wurde bei den Kämpfen 1945 zerstört), wird Herder, wie in Polen überhaupt, geschätzt und als Bestandteil der klassischen deutschen Philosophie – wie der Königsberger Immannuel Kant – angesehen. Hätten die Deutschen diese beiden Denker nicht nur gelesen, sondern ihre Gedanken auch beherzigt, wäre es ihnen besser ergangen, haben mir Polen nicht nur einmal gesagt. Für sie ist Herder das andere Deutschland. Und Herder selbst, obwohl geborener Preuße, hat seine Gedanken in Kleinstaaten – zuerst Bückeburg, dann Sachsen-Weimar – zu Papier gebracht. Machtstaatliches Denken war ihm fremd, und auch sein Herzog, wenn dieser allzu sehr auf Preußen setzte. In der gegenwärtigen Politik besinnen sich gerade Deutschland und Polen auf ihre Größe und auf ihren entsprechenden Einfluss. Ein Beitrag zum Her-der-Jahr ist das nicht, und zwar auf beiden Seiten. Ein Kleinstaat hat eben seine Vorteile – aber vielleicht auch nur, wenn ihm die Mächtigen die Existenz nicht streitig machen. Herder starb, bevor Napoleon nach Weimar kam. So ist ihm die eigene Utopie nicht genommen worden. »Meine große Friedensfrau hat nur einen Namen: sie heißt allgemeine Billigkeit, Menschlichkeit, tätige Vernunft..« Allen Lesern des Palmbaums ein gutes Jahr 2004.
Titelthema: Zum 200. Todestag von Johann Gottfried Herder (A. Reimann)
- Prosa: Siegfried Pitschmann, Wilhelm Bartsch, Wolfgang Haak, Bernd Zeller
- Lyrik: Edgar Leidel, Renate Montag, Friedrich Engelbert, Felicitas Kretschmann
- Essay: Wulf Kirsten, Albrecht Börner
- Interview: Klaus Steinhaußen, Ingrid Annel, Jan Volker Röhnert/Autoren (K. Agthe)
- Autoren der Gegenwart: Armin Müller (K. Bellin)
- Philosophiegeschichte: Arthur Schopenhauer (H. Förster-Stahl)
- Städte: Mühlhausen, Rudolstadt, Weimar.
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko.

Heft 36
EDITORIAL
Unsere Zeitschrift erscheint heuer im 11. Jahr, was für ein regional ausgerichtetes literarisches Periodikum sehr viel ist. Deshalb begehen wir das zehnjährige Bestehen von Verein und Journal mit einer ungewöhnlichen Veranstaltung. Diesmal soll das Publikum nicht zu uns kommen, wir gehen auf unsere möglichen Leser zu. In den beiden letzten August-Wochen treten wir im Jenaer Einkaufszentrum Goethe-Galerie (am Ort der ältesten Goethestraße Deutschlands) mit einer Goethe-Ausstellung an die Öffentlichkeit. Thematisiert werden die Aufenthalte des Dichters in der Saalestadt. Zählt man Tage, Wochen und Monate zusammen sind das mehr als fünf Jahre. Das Titelthema unseres Heftes ist deshalb Goethe gewidmet. Um sich dieses Weltautors anzunehmen, bedarf es keines Jubiläums.
Wenn wir auf andere Länder schauen, meist auf außereuropäische, blicken wir in einen für uns vielleicht fernen, in Wirklichkeit aber nahen Spiegel. Das hässliche Gesicht, das uns angrinst, ist auch, obwohl wir es nicht wahr haben wollen, unser Gesicht. Hässlichkeit vermuten wir »hinten weit in der Türkei«, vielleicht noch auf dem Balkan oder in Osteuropa, aber nicht in unseren scheinbar gesicherten Demokratien. Wir »West«-Europäer möchten gern die Guten sein. Selbst unsere eigenen dunklen Seiten nehmen wir nur noch als Geschichte wahr. Eine solche ahistorische und damit lebensfremde Sichtweise nennen wir Political Correctness und sehen uns mit ihr auf der Siegerseite. Und haben wieder einmal nichts gelernt, auch dass es in der Geschichte weder Sieger noch ewige Rechthaber gibt. Der Politiker Klaus von Dohnanyi möchte mit seinem bemerkenswerten Essay anregen, unser eigenes, scheinbar unerschütterliches Selbstverständnis zu hinterfragen.
Angesichts der allgemeinen Finanznot und der Einstellung der Palmbaum-Förderung durch den Freistaat Thüringen, hat der Vereinsvorstand in Absprache mit dem Verlag beschlossen, nur noch zwei Hefte im Jahr herauszubringen, diese allerdings in erweitertem Umfang. Wir wollen durchhalten und einen Sponsor finden. Besser aber wären viele neue Leser, Abonnenten.
Titelthema: Der Jenaer Goethe (A. Reimann, J.-F. Dwars)
- Prosa: Frank Quilitzsch, Peter Drescher
- Lyrik: Petra Arndt, Thomas Seifert, Joachim Werneburg, Günter Ullmann
- Essay: Klaus von Dohnanyi, Gisela Kraft
- Interview: Eberhard Haufe/Literaturwissenschaftler (K. Agthe)
- Autoren der Gegenwart: Annemarie Schimmel (K. Agthe)
- Literaturgeschichte: Kaspar Friedrich Lossius (M. Ludscheidt), Carl August (K. Bellin), Carl Gustav Jochmann (E. Haufe), Ludwig Storch (H. Weigel)
- Philosophiegeschichte: Meister Eckhart (H. Hoffmann, F. Lindner), Wilhelm Martin Leberecht de Wette (P. Saupe)
- Städte: Erfurt, Jena, Ruhla, Tambach-Dietharz, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko.

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 35
EDITORIAL
Mit unserer Zeitschrift möchten wir vor allem thüringische Autoren fördern, wo es uns möglich ist, aber auch über unsere engen Grenzen in die Welt hinausschauen. Deshalb sind wir froh, dass es in den vergangenen Jahren zwischen thüringischen und polnischen Autoren zu guten Kontakten und interessanten Arbeitsbeziehungen gekommen ist, was sich in Tagungen auf der »Literaturburg« Ranis und in Krakau niederschlug. Aus diesen Begegnungen ist nicht nur ein Palmbaum-Sonderheft, sondern auch das Titelthema dieses Doppelheftes hervorgegangen, das diesmal ganz gegenwärtig ist und uns wichtige Stimmen der aktuellen polnischen Literatur kennen lernen lässt. Auch in unserem sehr dichten Poesie-Teil sind wir »grenzüberschreitend«: wir stellen Lyriker aus allen drei mitteldeutschen Ländern vor, die sich in Weimar zu einer Lesung zusammengefunden haben. Selbstverständlich gibt es auch wieder zahlreiche literarhistorische Beiträge. Besonders hingewiesen sei auf die Aufsätze über Christian Friedrich Hunold und Kurt Kluge – zwei in ihrer Zeit vielgelesene, doch heute kaum noch gekannte Schriftsteller.
Obwohl die öffentlichen Kassen immer weniger gefüllt sind, gibt es den Palmbaum noch. Das Land hat sich bislang immer für unsere Zeitschrift eingesetzt und sie gefördert. Dafür sind Autoren, Redaktion und Verlag dankbar. Als unser literarisches Journal vor fast zehn Jahren gegründet wurde, hofften die Macher auf Unabhängigkeit: mit stetig steigenden Abonnentenzahlen würde sich die Finanzierung des Heftes schon bald von allein regeln. Das war eine Illusion. Eine Zeitschrift, wie sie uns vorschwebt, lässt sich nicht völlig ohne finanzielle Unterstützung machen. Dennoch wünschen wir uns mehr Leser (und Käufer), um den Palmbaum auch in Zukunft zu sichern. Informieren Sie also andere Literaturinteressierte über unsere Zeitschrift, empfehlen Sie sie weiter. Danke.
Allen Lesern des Palmbaum wünscht die Redaktion ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2003.
Titelthema: Polnisch-thüringisches Autorentreffen (Kai Agthe)
- Prosa: Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Maria Kolenda, Rainer Hohberg, Ingrid Annel, Holger Uske, Felicitas Kretschmann
- Lyrik: Wilhelm Bartsch, hans-Jürgen Döring, Thomas Böhme, Jan Volker Röhnert, André Schinkel, Daniela Danz, Holger Bänkel, Undine Materni, Ron Winkler, Bärbel Klässner, Holger Helbig, Christine Hannsmann
- Autoren der Gegenwart: Jutta Hecker (K. Bellin), Siegfried Pitschmann (M. Straub), Klaus Rohleder (V. Müller)
- Literaturgeschichte: Athanasius Kircher (D. Ignasiak), Fruchtbringende Gesellschaft (F. Boblenz), Menantes (C. Hobohm), Johann Wolfgang von Goethe (J.-F. Dwars), Erwin Strittmatter (Th. Schikora)
- Verlags- und Buchgeschichte: Frommann-Verlag (G. Schmidt)
- Städte: Bad Salzungen, Gera, Gotha, Jena, Saalfeld, Suhl, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko.

Heft 34
EDITORIAL
Die Veröffentlichung der nationalen Ergebnisse der »Pisa-Studie« (Programme for International Student Assessment) brachte keine wirklichen Überraschungen. Dass Bayern an der Spitze stehen würde, war vorauszusehen, zumindest für diejenigen, die sich schon einmal an bayerischen Schulen umgesehen haben und sie vergleichen konnten mit denen von Bremen oder dem Saarland. Es geht eben bei unserem südlichen Nachbarn ein bisschen »preußischer« zu, auch wenn dort – wie überall in Deutschland – die in Jahrhunderten gewachsenen klassischen Bildungsfächer längst dem Zeitgeist der »Erlebnisgesellschaft« geopfert wurden. Freuen wir uns aber, dass sich wenigstens Thüringen im Mittelfeld wiederfindet. Immerhin sind unsere 15-jährigen Schüler in der Lesekompetenz wenigstens durchschnittlich, was wohl auch der soliden Ausbildung unserer Lehrer, sicher auch der Unterstufenlehrer zu danken ist. Zum Lernen und vor allem zum Erwerb von Fertigkeiten wie Lesen und Rechnen braucht man Ruhe, Disziplin, Kontinuität, also alles Dinge, die es an unseren Schulen schon längst nicht mehr gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mit dem »Palmbaum« in die allgemeine Bildungsdiskussion einbringen würden. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung!
Titelthema: Burgenromantik an der Saale (K. Agthe)
- Prosa: Inge von Wangenheim, Matthias Biskupek
- Lyrik: Hanns Cibulka, Stefan Schütz, Bärbel Klässner, Lutz Rathenow, Juliane Blech
- Essay: Siegfried Nucke
- Interview: Inge von Wangenheim/Schriftstellerin (W. Knappe)
- Autoren der Gegenwart: Inge von Wangenheim (J.-F. Dwars)
- Literaturgeschichte: Johann Gottfried Seume (K. Bellin)
- Verlags- und Buchgeschichte: Hermann Costenoble (G. Schmidt)
- Städte: Bad Kösen, Jena, Naumburg, Rudolstadt, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko.

Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Heft 33
EDITORIAL
Der »Palmbaum« lebt, gibt sich sogar mit diesem Heft ein neues Gesicht, doch keinen neuen Inhalt. Auch weiterhin sollen vor allem Thüringer Autoren im »Palmbaum« zu Wort kommen, sollen Kapitel der reichen thüringischen Kulturlandschaft aufgeschlagen werden. Diesmal nehmen wir Bezug auf zwei Jubiläen: auf den Geburtstag eines Herzogs, dem die Thüringische Literarhistorische Gesellschaft im vergangenen Jahr eine wissenschaftliche Konferenz gewidmet hat; auf den 80. Geburtstag eines südthüringischen Dichters, der wie kaum ein anderer im 20. Jahrhundert die thüringische Landschaft poetisiert hat. Zum anderen stellt sich unser langjähriger Beiträger Kai Agthe nun auch als Palmbaum-Redakteur vor. Mit seinem Engagement hoffen wir, trotz weiterhin knapper Finanzen, Kontinuität wahren zu können.
Als das letzte Heft im Dezember ausgeliefert wurde, war der Fortbestand des Deutschen Nationaltheaters Weimar als eigenständiger Kunstbetrieb noch nicht gesichert. Jetzt ist zumindest das von der Kunstministerin geforderte unselige Fusionsvorhaben mit dem Stadttheater Erfurt vom Tisch. Ohne den öffentlichen Protest vieler Freunde des Weimarer Theaters wäre wohl ein solches Ergebnis nicht zustande gekommen. Manchmal lohnt es doch, seine Meinung kundzutun. Aber man muss auch ins Theater gehen!
Titelthema: Zum 80. Geburtstag von Walter Werner (K. Gasseleder, W. Kirsten)
- Prosa: Hubert Schirneck, Elisabeth Dommer, Heide Haßkerl
- Lyrik: Horst Samson, Daniela Danz, Jan Röhnert, Henni Meininger
- Essay: Hans Kaufmann, Gisela Kraft
- Interview: Detlef Ignasiak/Verf. eines Literaturkanons (K. Agthe)
- Autoren der Gegenwart:
- Literaturgeschichte: Radegunde (D. Ignasiak), Ernst der Fromme (D. Ignasiak), Gustav Freytag (J. Schröder), Gabriele Reuter (K. Agthe)
- Philosophiegeschichte: Friedrich Nietzsche (J.-F. Dwars)
- Städte: Gotha, Meiningen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko.
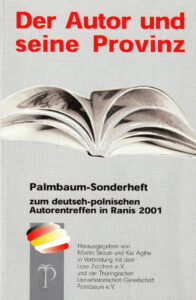
Einbandgestaltung: KMD Grafik- & Designatelier Weimar
Vorwort
Henryk Bereska war der Erste, der vor zwei Jahren die Autorenwohnung auf Burg Ranis bezog. Nach seinem Aufenthalt schrieb er: „… die zwei geschmackvoll renovierten Räume bieten einem genügend Platz zum peripatetischen Nachdenken, der Blick aus dem Fenster gleitet in drei Himmelsrichtungen über eine Landschaft, die allein schon den Betrachter poetisch inspiriert.« Auf Vermittlung von Henryk Bereska folgten Dr. Gabriela Matuszek aus Kraköw und Dr. Jerzy Lukocs aus Wroclaw nach Ranis. Ihre Ausflüge nach Weimar führte sie mit Thüringer Autoren zusammen. Die ersten Pläne für ein Autorentreffen auf der Burg wurden geschmiedet. Ermutigung und tatkräftige Unterstützung bekamen wir durch die Thüringer Staatskanzlei, den Verband Deutscher Schriftsteller und durch das Auswärtige Amt.
„Der Autor und seine Provinz« lautete das Thema des Arbeitstreffens, das dann zwischen dem 7. und 10. Oktober 2001 auf Burg Ranis und in Jena stattfand. Neue Verbündete gesellten sich hinzu: das Collegium Europaeum Jenense der Friedrich-Schiller-Universität, der Lehrstuhl für Slawische Literaturwissenschaft der Jenaer Universität, das Polnische Institut in Leipzig und nicht zuletzt das Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Zehn polnische und zehn deutsche Autoren aus Thüringen trafen sich, trugen vor, lasen vor und diskutierten. Es gab öffentliche Lesungen auf der Burg und im Schiller-Gartenhaus in Jena. Beide waren gut besucht. Zudem war in der Galerie West-erheide (Ranis) junge polnische Kunst zu sehen.
Der vorliegende Band stellt die Beiträge dieses Treffens vor. Und vielleicht teilt sich ja durch ihn etwas von der Atmosphäre dieser drei Tage mit. Mit Staunen wurden der poetische Reichtum des „Anderen« zur Kenntnis genommen. Die polnischen Autorinnen und Autoren, sprachmächtig und sprachgewandt, übersetzten nicht nur die Tagung live, sondern auch Lyrik und Prosa Thüringer Autoren. Dafür sei Gabriela Matuszek, Henryk Bereska, Iwona Mickiewicz, Maria Kolenda und Jerzy Lukosc besonders gedankt. Es wurden keine Statements verkündet. Vielmehr lebte die Tagung von ihrem Werkstattcharakter. So verschieden die Vorstellungen von der jeweiligen Provinz waren, so dringlich wurden die Fragen nach einer eigenen Sprachwelt gestellt.
Die versammelten Arbeiten geben darüber Auskunft, wie sich Landschaften gelebten Lebens in Textlandschaften wandeln. Sie sind Zufluchtsorte und zugleich Durchgangsorte von Welt und Geschichte. So hat das Raniser Dichtertreffen Spuren gelegt. Und das Wichtigste: man lernte sich kennen, die Sprach- und Lebensgründe des Nachbarn. Viel wurde gesprochen über Wendepunkte deutscher und polnischer Geschichte. Wie man uns sagte, war es das erste offizielle polnisch-deutsche Dichtertreffen in Thüringen. Solche Feststellung bedürfte eines eigenen Kommentars.
Karol Maliszewski hat die besondere Burg-Stimmung trefflich in einem Gedicht „Ranis im Oktober« am Schluss seines Beitrages festgehalten. Es sagt mehr als dieses Vorwort. Setzen wir das Begonnene fort.
Dr. Martin Straub, Jena, im Mai 2002
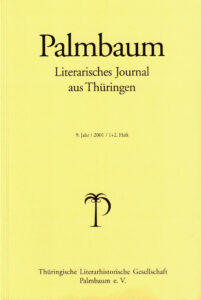
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 32
EDITORIAL
Dass die Finanzen für die Kultur knapp bemessen sind, ist nichts Neues. Auch nicht, dass es die Theater in besonderem Maße trifft. Goethe konnte die Kassen seines Hoftheaters noch durch das Spielen von reiner Unterhaltung füllen. Da es dafür heute andere Medien gibt, geht das nicht mehr. Der Theaterbetrieb braucht Steuergelder. Am teuersten ist die Oper, die immer weniger Menschen anspricht. Ein Kulturumbruch scheint im Gange. Das Mehrspartentheater, das auch Goethe favorisierte und das sich im 19. Jahrhundert allgemein durchgesetzt hat, ist der Beitrag der deutschen Schaubühne zum Welttheater, wird aber wohl keine Zukunft haben, denn das Bildungsbürgertum, von dem es getragen wurde, gibt es (fast) nicht mehr. Es sah im Theater variierte Literatur, und die klassischen deutschen Dramen sind vor allem Literatur. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Regietheater aktueller Prägung. Schlimm wird es für sie, wenn sich der Regisseur klüger weiß als der Dichter. Shakespeare mag dann noch funktionieren, auch Goethes »Faust«, Schiller aber nicht. Vielleicht gehen auch deshalb heute weniger Leute ins Theater. 1990 verfügte Thüringen mit den Ensembles in Weimar, Erfurt, Eisenach, Nord-hausen, Meiningen, Rudolstadt, Gera und Altenburg noch über acht Mehrspartentheater. Jetzt sind es nur noch fünf, und in kurzer Zeit werden es noch weniger sein. Wenn man auch Weimar sterben lässt, gibt man die ganze in Jahrhunderten gewachsene thüringische Theaterlandschaft auf. Weimar, dessen Theater immer lebendige Literatur war, kein Event, das man sich von irgendwo herholt, und wenn es sein muss, das Publikum gleich mit, wird dann endgültig ein Museum sein. Aus dem Goetheschen Theaterkonzept entwickelte sich nicht zwangsläufig ein Nationaltheater, ein Theater für die Menschen aber allemal. Wir sind für ein eigenständiges, Schauspiel und Oper gleichermaßen umfassendes Theater in Weimar!
Titelthema: Zum 200. Geburtstag von Ludwig Bechstein (H. Weigel, A. Erck, H. Schneider, H.-J. Uther)
- Prosa: Stefan Raile, Sigrid Ramge, Kristina Schade
- Lyrik: Kai Agthe, Gerhard Tänzer, Manfred Ostückenberg, Maik Lippert, Holger Uske
- Dramatik: Albrecht Börner
- Essay: Volker Müller, Annerose Kirchner
- Autoren der Gegenwart: Karl-Heinrich Bonn (F. Lindner), Wolfgang Rinecker (K. Wagner), Kathrin Schmidt (D. Jacobsen)
- Literaturgeschichte: Johann Peter Uz (H. Gerlach), Johann Wolfgang von Goethe (G. Kraft)
- Städte: Gotha, Meiningen, Römhild, Waltershausen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
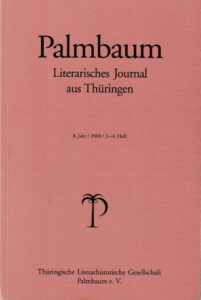
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 31
EDITORIAL
Wenngleich in allen literarischen Epochen immer auch Frauen zur Feder gegriffen und bedeutende Werke geschrieben haben, ist ihr Anteil insgesamt doch gering. Das änderte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Schriftstellerinnen nahezu alle Genres eroberten, sich aber bis heute insbesondere im dramatischen Fach schwer tun. Im Titelthema dieses Heftes werden zwei Schriftstellerinnen des frühen 18. Jahrhunderts vorgestellt und danach befragt, welche Möglichkeiten sie hatten, sich in das von den Männern dominierte literarische Leben einzuordnen. Und mit Louise Seidler wird eine bislang wenig beachtete Memoirenschreiberin porträtiert.
Wenn auch in den meisten Palmbaum-Beiträgen Thüringen fühlbar ist, so war es doch von Anfang an unser Ziel, in jedes Heft so viel Welt wie möglich hinein zu holen. Diesmal haben die Autoren Frankreich, Italien, Irland, die Niederlande, Russland, Polen und Litauen in den Blick genommen. Was wir sind, sind wir auch durch die anderen; und was die anderen sind, sind sie auch ein wenig durch uns. Wir können froh sein, dass Thüringen mitten in Europa liegt und unsere Straßen in alle Richtungen gehen.
Auch im Jahre 2001 stehen wieder wichtige literarische Jubiläen ins Haus. Zu nennen sind der 250. Geburtstag des unglücklichen Stürmers und Drängers Jakob Michael Reinhold Lenz (23.1.), der 250. Geburtstag des Idyllendichters und genialen Homer-Übersetzers Johann Heinrich Voß (20.2.), der 200. Todestag des Romantikers Novalis (25.3.), der 400. Geburtstag des wirkungsreichen ersten Schulbuch-verfassers Andreas Reyher (4.5.), der 150. Geburtstag des „Thüringer Wandersmanns« August Trinius (31.7.), der 200. Geburtstag des Märchen- und Sagensammlers Ludwig Bechstein (24.11.) und der 400. Geburtstag von Herzog Ernst dem Frommen (25.12.), dem die Thüringische Literarhistorische Gesellschaft Palmbaum e.V. Anfang April in Gotha eine wissenschaftliche Konferenz widmen wird.
Detlef Ignasiak
- Titelthema: Schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert (F. Marwinski)
- Prosa: Heide Haßkerl, Matthias Biskupek, Elisabeth Dommer
- Lyrik: Gisela Kraft, Annerose Kirchner, Radjo Monk, Claudia Weise
- Essay: Dagmar Hirsch, Annerose Kirchner
- Literaturgeschichte: Johann Beer (R. Jacobsen), Jakob Lenz (D. Ignasiak), Corona Schröter (E. Rauch), Louise Seidler (S. Kaufmann), Ernst Wiechert (Ch. Langner)
- Philosophiegeschichte: Ernst Haeckel (R. D. Precht)
- Städte: Erfurt, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
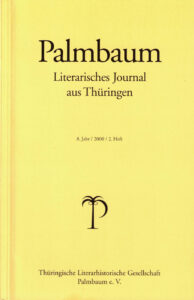
Einbandgestaltung Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 30
EDITORIAL
Am 25. Oktober 775 überließ Karl der Große in einem Schreiben dem Kloster Hersfeld die Zehntabgaben von sechs Höfen aus dem Besitz der vil& Gothaha. Aus dieser darin erstmals – also vor 1225 Jahren – urkundlich erwähnten Siedlung gingen Ort und Stadt Gotha hervor. Der althochdeutsche Ortsname bedeutet soviel wie „gutes Wasser«, geht also nicht – wie durch die Sage lange angenommen – auf den Hersfelder Abt und späteren Hildesheimer Bischof Godehard zurück. Dennoch ziert dessen Bild das Wappen der Stadt. Gotha war im 17., 18. und 19. Jahrhundert ein bedeutendes literarisches Zentrum. Deshalb nehmen wir das Ortsjubiläum zum Anlass, in diesem Heft auf Schriftsteller aufmerksam zu machen, die mit Gotha verbunden sind. Dabei wird der Bogen bis in die Gegenwart gespannt: Der vor wenigen Wochen 80 Jahre alt gewordene Dichter Harms Cibulka – wir haben im Palmbaum erst kürzlich einen Auszug aus seinem neuen Buch abgedruckt – hat das literarische Leben der Stadt in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt. Und Sigrid Damm, die sich init ihrem Buch „Christiane und Goethe« seit Monaten in den Bestsellerlisten hält, stammt aus Gotha. Sie wird demnächst 60 Jahre alt.
Der Büchner-Preis, den alljährlich im Herbst die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verleiht, ist die angesehenste Auszeichnung der deutschen Literatur. In diesem Jahr, dem zehnten seit der Wiederherstellung der deutschen Einheit, erhielt ihn Volker Braun, dessen Wende-Vers uns noch in den Ohren klingt: „Da bin ich noch: Mein Land geht in den Westen.« Für ihn war die DDR Stoff zum Leben und zum Dichten. Im Unterschied zu den anderen, die sich an diesem Staat rieben, hatte der studierte Philosoph den großen Gesellschaftsentwurf stets ernst genommen und gerade deshalb dessen Scheitern früh vorausgesehen. Wer in den 80er Jahren Brauns Stück „Die Übergangsgesellschaft« auf dem Theater sah, wurde aller Illusionen beraubt. Dass Brauns Texte nun auch im Westen häufiger gelesen werden, wird unserem Land gut tun.
Detlef Ignasiak
Titelthema: Gothas Platz in der Literaturgeschichte (D. Ignasiak, Ch. Große, U. Kaufmann)
- Prosa: Sigrid Ramge, Verena Zeltner, Rainer Hohberg
- Lyrik: Armin Müller, Joachim Werneburg, Jenny Feuerstein, Günter Ullmann
- Essay: Frank Quilitzsch
- Interview: Dieter M. Weidenbach (J.-F. Dwars)
- Autoren der Gegenwart: Sigrid Damm (U. Kaufmann), Joachim Lehmann (D. Ignasiak), Jürgen Fuchs (V. Müller)
- Philosophiegeschichte: Friedrich Nietzsche (H. Völkerling)
- Städte: Gotha, Greiz, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
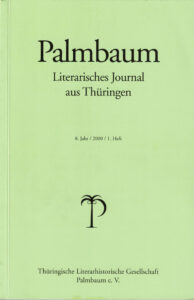
Einbandgestaltung Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 29
EDITORIAL
Vor hundert Jahren, am 25. August 1900, stirbt Friedrich Nietzsche in Weimar. Dass das Leben des wirkungsmächtigen Philosophen in der Stadt Goethes endet, ist der Wunsch der Schwester Elisabeth. Er selbst wird seinen Aufenthalt an dem traditionsbeladenen Ort nicht mehr wahrgenommen haben. Seine eigentliche Heimatstadt ist Naumburg, wohin der in Röcken bei Lützen Geborene nach dem frühen Tod des Vaters mit der Mutter schon im Alter von sechs Jahren kommt, und wohin er Zeit seines Lebens immer wieder zurückgekehrt ist. Nietzsche ist – wie Luther – ganz ein Kind der mitteldeutschen Landschaft, zudem ein Spross der seit der Reformation gewachsenen Pfarraristokratie. Und wie der Theologe hat auch der Philosoph vor allem auf die Menschen der nachfolgenden Generation(en) gewirkt. Dazu schreibt der Dichter Gottfried Benn: »Eigentlich hat alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinanderdachte, man kann sagen: erlitt, man kann sagen: breittrat – alles das hatte sich bereits bei Nietzsche ausgesprochen und erschöpft, definitive Formulierung gefunden …« Im Palmbaum ist schon mehrfach (3/1993, 3/1994, 3/1997) über den Philosophen geschrieben worden, und auch im nächsten Heft kommen wir auf ihn zurück.
Wiederum ein Wort in eigener Sache: Seit 1999 hat der Palmbaum e.V. drei Literatur- und Kunstreisen organisiert: nach Rom, nach Florenz (siehe dazu den Bericht in diesem Heft) und vor kurzem nach West- und Ostpreußen (Polen, Russland, Litauen). Das Interesse an diesen Unternehmungen war außerordentlich groß, so dass die Rom-Reise Ostern 2001 zum zweiten
Mal wiederholt wird, die Ostpreußen-Reise vermutlich im Sommer 2001. Ausführliche Informationen dazu und zu anderen Vorhaben können dem nächsten Heft entnommen oder bei der Redaktion abgefragt werden.
Detlef Ignasiak
Titel: Zum 100. Todestag von Friedrich Nietzsche (J.-F. Dwars, H.J. Schmidt, K. Agthe)
- Prosa: Antje Babendererde, Dorothee Zahn
- Lyrik: Gisela Kraft, Ingeborg Stein, Brigitte Rost
- Essay: Volker Müller, Kai Agthe
- Literaturgeschichte: Erhard Weigel (G. Schmidt), Fritz Scheffel (P. Drescher)
- Städte: Bad Salzungen, Eisenach, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 28
EDITORIAL
»Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert. Und mehr als das Blei in der Flinte das im Setzkasten«, behauptete Georg Christoph Lichtenberg. Weil er Recht hatte, wurde Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks mit
beweglichen Lettern und damit der Massenkommunikation, von amerikanischen Journalisten zum Mann des Jahrtausends gekürt. Dass es in diesem Jahr ein Gutenberg-Jubiläum gibt, passt gut in die Zeit, erleben wir doch gerade einen neuen Umbruch in unseren Massenkommunikationssystemen. Auch davon handelt der erste Beitrag dieses Heftes. Wenn auch Johann Sebastian Bach, der andere große Jubilar des Jahres 2000, nur wenig mir Literaturgeschichte zu tun har, kommen wir doch in zwei kleineren Beiträgen auf ihn zurück. An anderer Stelle blicken wir nocheinmal auf das Goethe-Jahr und stellen einige bemerkenswete Neuerscheinungen zu diesem Thema vor.
Doch noch ein Wort in eigener Sache: Der »Palmbaum« soll viermal im Jahr erscheinen. Bislang war das auch immer so. Doch im letzten und zu Beginn dieses Jahres gab es Schwierigkeiten. Diese hingen aber nicht mit den immer knapper werdenden Finanzen zusammen. Viel eher mit dem Ausfall des derzeit einzigen Redakteurs krankheitshalber. In diesem Jahr müssen also fünf Hefte ausgeliefert werden. Der Redakteur hofft, in der Mitte des Jahres das schlingernde Palmbaumschiff wieder auf Kurs gebracht zu haben. Unterstützen sie ihn mit Nachsicht und Geduld.
Der »Palmbaum« wird wieder allein von der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft herausgegeben, denn das Literaturbüro Thüringen, das in Erfurt beheimatet war und die zahlreichen literarischen Institutionen im Land koordinieren sollte, hat im März seine Arbeit eingestellt. Die Bedeutung der einzelnen literarischen Gesellschaften ist also wieder gestiegen.
Titelthema: Zum 600. Geburtstag von Johannes Gutenberg (G. Schmidt)
- Prosa: Wolfgang Held, Hanns Cibulka, Siegfried Nucke
- Lyrik: Ron Winkler, Kai Agthe, Joachim Lehmann, Mira Ebendorff, Angelika Eichhorn, Renate Siebenhaar
- Autoren der Gegenwart: Harald Gerlach (W. Kirsten)
- Literaturgeschichte: Johann Stigel (D. Ignasiak)
- Germanistikgeschichte: Hans Kaufmann (K. Krippendorf)
- Städte: Erfurt, Gotha, Jena
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
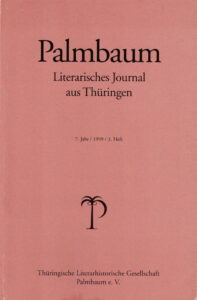
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 27
EDITORIAL
Seit 1901 verleiht die Schwedische Akademie in Stockholm die Nobelpreise. Die Dotierungen stammen noch immer aus dem finanziellen Erbe des Dynamit-Erfinders. Ein Glück, daß der ein Schwede war …
Von den mittlerweile jährlich sechs vergebenen Nobelpreisen ist der für Literatur der einzige für eine künstlerische Tätigkeit. Ausdruck auch für das hohe Ansehen der Schriftstellerei noch vor einem knappen Jahrhundert! Von den 95 Autoren, die seither mit diesem Preis geehrt wurden, bedienten sich elf der deutschen Sprache. Der bislang letzte ist Günter Grass. Dem Autor der „Blechtrommel« wird der Preis in den nächsten Tagen von König Carl XVI. Gustav überreicht werden. Darüber freuen wir uns sehr. Deshalb ist dieses Editorial auch diesem Thema gewidmet.
Günter Grass steht in einer Reihe mit Theodor Mommsen (1902), Rudolf Eucken (1908), Paul Heyse (1910), Gerhart Hauptmann (1912), Carl Spitteler (1919), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), Nelly Sachs (1966), Heinrich Böll (1972) und Elias Canetti (1981). Wer kennt außerhalb Jenas heute noch den Philosophen Rudolf Eucken? Wer liest noch Paul Heyse und wer Carl Spitteler? Sic transit gloria mundi — auch der von Nobelpreisträgern! Alles in allem aber hat die Schwedische Akademie doch eine gute Wahl getroffen, wenngleich man Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Joseph Roth oder Bertolt Brecht nicht unter den Geehrten findet. Das liegt vielleicht an ihrem frühen Tod. Nobelpreisträger sind selten junge Menschen.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden sieben deutschsprachige Autoren geehrt, in der zweiten nur noch vier. Dahinter stecken kaum politische Bedenken, wie die Hesse-Ehrung 1946 zeigt! Das hat etwas mit der immer geringer werdenden Wirkung von deutscher Literatur (und Sprache) in der Welt zu tun! Zum einen haben wir daran selbst schuld, zum anderen aber auch die geringe Qualität unserer Literatur. Welche deutschen Autoren im Alter von 30, 40 Jahren erregen im Ausland schon die Gemüter? Das war vor 100 Jahren, als die Nobelpreise gestiftet wurden, völlig anders. Freuen wir uns auf ein neues Jahrhundert deutscher Literatur.
Titelthema: Das Jenaer Romantikertreffen vor 200 Jahren (U. Kaufmann)
- Prosa: York Sauerbier, Andrea Horn, Annerose Kirchner
- Lyrik: Thomas Spaniel, Felicitas Kretschmann, Gerd W. Heyse
- Dramatik: Albrecht Börner, Hans Lucke
- Essay: Dietmar Jacobsen
- Autoren der Gegenwart: Reiner Kunze (V. Müller), Wulf Kirsten (K. Agthe)
- Philosophiegeschichte: Carl Forberg (F. Lindner), Johann Gottlieb Fichte (J.-F. Dwars)
- Städte: Greiz, Jena, Saalfeld, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
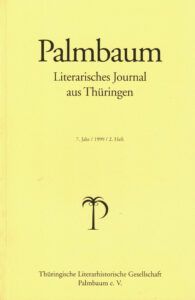
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 26
EDITORIAL
Die Feiern zu Goethes 250. Geburtstag sind durchgestanden, auch der größere Teil des Kulturstadtjahres. Es gilt allgemein als gelungen, wenngleich viele Wünsche offenblieben. Auch auf dem Theater. Die Faust-Inszenierung des Jahres ist nicht am Deutschen National-Theater zu sehen, sie läuft seit kurzem in Leipzig. Schade! Auf den Straßen Weimars wurde an Goethes Geburtstag zwar viel Theater gespielt, doch kein Klassiker-Text war zu hören! Zum Romantiker-Jubiläum in Jena kamen die Geehrten auf der Straße selbst zu Wort – im nächsten Heft werden wir über dies Straßenliteraturfest (so etwas kann es wirklich geben) berichten. Darf Klassik nicht mehr populär sein? Dürfen Klassiker nicht mehr so gespielt werden, daß auch der weniger Kunstbeflissene seinen Spaß daran haben kann?
Doch noch ein Wort zu einem anderen Thema, das wir im Palmbaum bislang vernachlässigt haben, obwohl es uns alle angeht. Seit dem 1. August erscheinen die meisten deutschen Zeitungen und Zeitschriften (wie auch die Texte in den elektronischen Medien) – gewissermaßen in einer Art vorauseilenden Gehorsams – in der »neuen« deutschen Rechtschreibung. Der Palmbaum hat sich zu dieser »Umstellung« noch nicht durchringen können, weil er noch lange glaubte, daß sich diese «dümmste aller Reformen des ausgehenden Jahrhunderts« (Dietz-Rüdiger Moser in: Literatur in Bayern, Ausgabe Nr. 57/1999, S. 80) noch verhindern ließe. Was aber jetzt schon abzusehen ist: diese »Reform« hat weder den Lesern noch den Schreibern Vorteile gebracht. Eher dürfte das Gegenteil der Fall sein: die reformierte Groß- und Kleinschreibung sowie die Getrennt- und Zusammenschreibung beraubt uns weiterer Ausdrucksmöglichkeiten. öffnet Mißverständnissen Tür und Tor. Wenn der Palmbaum ab Januar 2000 nicht umhin kommen wird, die »neue« Rechtschreibung anzuwenden, so wird er dies nur in einer sehr gemäßigten Form tun. Wir kommen im nächsten Heft darauf zurück.
Titelthema: Zum 250. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe (J.-F. Dwars, J. Völkerling)
- Prosa: Peter Drescher, Lutz Rathenow, Anne Kneip
- Lyrik: Claus Ritter, Günter Ullmann, Bernd Dittrich, Holger Uske, Matthias-Werner Kruse, Gerda Maria Arndt
- Essay: Volker Müller, Frank Lindner
- Autoren der Gegenwart: Jutta Hecker (D. Fechner, D. Ignasiak), Claus Ritter (K. Hammer), Sarah Kirsch
- Literaturgeschichte: Gottfried Benn (T. Medek), Ilse Langner (M. Melchert)
- Städte: Altenburg, Gera, Jena, Nordhausen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
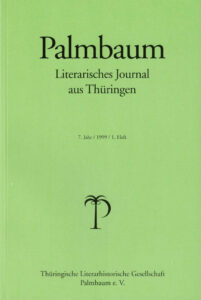
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 25
EDITORIAL
Mit diesem Heft halten Sie, liebe Leserinnen und Leser, die 25. Ausgabe des »Palmbaum« in Händen. Die Freude an diesem kleinen Jubiläum wird getrübt durch den Tod unseres Freundes und »Palmbaum«-Redakteurs Helmut Nitzschke. Daß es die Zeitschrift nun schon so lange gibt, ist auch sein Verdienst. Wir fühlen uns ihm in tiefer Dankbarkeit über den Tod hinaus verbunden. Daß wir ihn nicht ersetzen konnten und wollten, sehen Sie am verspäteten Erscheinen dieses Heftes. Das Sommerheft wird – wie gewohnt – im Juli ausgeliefert werden.
Zahlreiche Beiträge in diesem Heft beziehen sich auf den wichtigsten Jubilar dieses Jahres. Auch in der nächsten Ausgabe wollen wir an Goethe nicht vorbeigehen. Natürlich hat der Dichter weltweit gewirkt, doch in Thüringen war er mehr als 50 Jahre zu Hause. Daß es Goethe in dem kleinen Weimar so lange ausgehalten hat, leuchtete schon so manchen Zeitgenossen nicht recht ein. Da scheint es nur folgerichtig zu sein, daß er auch noch andere Lebensorte hatte: Jena, Italien, am Rhein – und die böhmischen Bäder, wo er den Großen der Welt oft ganz nahe war.
Als Eckermann im Spätsommer 1823 Weimar nach nur wenigen Monaten wieder verlassen wollte, hat Goethe ihn zum Bleiben aufgefordert und seine Beziehung zur Stadt erläutert. »Wo finden Sie«, läßt Eckermann »seinen« Goethe sagen, »auf einem so engen Fleck noch so viel Gutes! Auch besitzen wir eine ausgesuchte Bibliothek und ein Theater, was den besten anderer deutschen Städte in den Hauptsachen keineswegs nachsteht. Ich wiederhole daher: bleiben Sie bei uns, und nicht bloß diesen Winter, wählen Sie Weimar zu Ihrem Wohnort. Es gehen von dort die Tore und Straßen nach allen Enden der Welt … Ich bin seit fünfzig Jahren dort, und wo bin ich nicht überall gewesen! – Aber ich bin immer gerne nach Weimar zurückgekehrt.«
Titelthema: Zum 250. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe (A. Reimann)
- Prosa: Renate Montag, Ruth Friedel
- Lyrik: Volker Braun, Rüdiger Koch, Ingo Cesaro, Jürgen Köditz
- Interview: Angelika Reimann/Goethe-Forscherin (D. Ignasiak), Jens-Fietje Dwars (U. Kaufmann)
- Autoren der Gegenwart: Christa Wolf (S. Pitschmann), Volker Braun (U. Kaufmann), Günter Ullmann (V. Müller), Christoph Eisenhuth (G. Gerstmann)
- Literaturgeschichte: Johann Wolfgang von Goethe (F. Piontek), Marianne von Eybenberg (W. Schilling)
- Philosophiegeschichte: Johann Gottlieb Fichte (G. Schmidt)
- Städte: Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 24
EDITORIAL
Wenn in der Silvesternacht 1998 die Glocken davon künden, daß das vertraute Millennium bald seinem Ende entgegengeht, mögen Endzeit-stimmungen in den Gefilden des Geistigen vielleicht nicht ähnlich übermächtig sein wie beim letzten Fin de siècle in den ausgehenden 1890er Jahren. Zu sehr ist 2000 eine Jahreszahl, mit der sich manche – wenn auch nur allzu gedämpfte – Hoffnungen verbinden. Gleichwohl ist es nicht ohne Sinnfälligkeit, das vorliegende Heft mit zwei Endzeit-Texten unterschiedlicher Art zu eröffnen. Lutz Rathenow malt in einer satirischen Groteske aus, wie es hätte werden können, wenn die Endzeit der DDR sich bis über deren 50. Jahrestag am 7. Oktober 1999 hingezogen hätte. Vieles wäre dann unvorstellbar anders, und ganz gewiß gäbe es auch den »Palmbaum« nicht, dessen 25. Heft wir jetzt schon vorbereiten. Ulman Weiß hingegen blickt historisch 650 Jahre zurück – auf jene von Untergangserwartungen geschüttelte Zeit um 1350, als der Schwarze Tod in Thüringen grassierte und apokalyptische Ängste sich in grauenhaften Judenmorden einen irrwitzigen Ausweg bahnten.
Nicht nur in Endes Zeichen steht das beginnende Jahr, sondern vor allem in dem des Gedenkens – an Johann Wolfgang von Goethe und seinen 250. Geburtstag am 28. August. Wir lassen ihn mit »Ansichten« über Weimar – die »Kulturstadt Europas 1999« – zu Wort kommen und kündigen unseren Lesern für das erste Heft des neuen Jahres weitere Goethe-Beiträge an.
Worte des Nachrufs stehen für zwei im November Verstorbene: Margarete Braungart in Hildburghausen und Erich Kriemer in Gera. – Und hingewiesen sei besonders auf das Gespräch mit Gisela Kraft – deren Wahlheimat Weimar geworden ist – über ihren »romantischen Roman« »Madonnensuite« und auf die Besprechung von Günter Ullmanns »Die Sonne taucht im Wassertropfen« – ein Büchlein mit wunderschönen Kindergedichten.
Die Herausgeber
Titelthema: Pest und Judenmord vor 650 Jahren (U. Weiß)
- Prosa: Margarete Braungart, Lutz Rathenow, Ines Eck, Charlotte Bechstein, Stefan Schoblocher, Hannes Bosse
- Lyrik: Christoph Eisenhuth, Friedrich Engelbert, Barbara Martin, Thomas Lux, H. Jürgen Heimrich
- Mundart: Anneliese Hübner
- Interview: Gisela Kraft/Dichterin (U. Kaufmann)
- Essay: Dagmar Hirsch
- Autoren der Gegenwart: Ibrahim Böhme (V. Müller), Margarete Braungart (H. Nitzschke), Martin Stade (H. Stade)
- Literaturgeschichte: Sage vom Schmied von Ruhla (D. Hirsch)
- Städte: Erfurt, Greiz, Hildburghausen, Ruhla, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
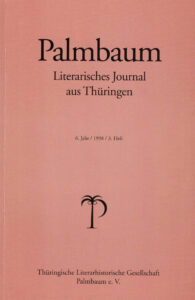
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 23
EDITORIAL
Unser Titelthema gehört in diesem Heft einem lebenden Dichter. Einem Schlesier, der durch die Umbrüche des 20. Jahrhunderts nach Thüringen gekommen ist und seither in beiden Kulturlandschaften zu Hause ist. Die Rede ist von Armin Müller, dem malenden Poeten aus Weimar. Am 25. Oktober wird er siebzig Jahre alt. Wir gratulieren und stellen ihn als Erzähler, Lyriker und Maler vor.
Gedichte und Prosatexte befinden sich auch noch an anderer Stelle dieses Heftes, vornehmlich von Frauen ganz unterschiedlicher Generationen. Aufgefallen sind uns vor allem die Texte von Johanna Lüdde, Jennv Feuerstein und Uljana Wolf. Wir sollten die künstlerische Entwicklung dieser jungen Damen im Auge behalten. Es wird sich vermutlich lohnen.
Der Rezensionsteil dieses Heftes ist besonders umfänglich geraten, wie wir hoffen wollen auch inhalts- und gedankenreich. Daß der »Palmbaum« inzwischen fast über so etwas wie einen Rezensentenstamm verfügt, freut uns sehr.
Lassen Sie uns nocheimnal nach Weimar blicken, wo das Gebäude des Deutschen National-Theaters dem Ende seiner Sanierung entgegensieht, worüber wir uns gleichfalls freuen; im Kulturstadtjahr 1999 wird es seine Pforten wieder öffnen und, so hoffen wir wenigstens, von den Besuchern aus aller Welt als ein Theater von Rang, als eine unverwechselbare, traditionsreiche Spielstätte angenommen werden. Nicht auszudenken ist es aber, daß das Theater Goethes und Schillers ab dem neuen Jahrhundert als »Stadttheater« (was es in Weimar nie gab) firmieren soll, noch dazu im Verbund mit dem Erfurter Theater, das aus einer völlig anderen Tradition hervorgegangen ist. Auch in den Zeiten knapper Kassen sollten nicht auch noch die »Filetstücke« (wie es im ›Wirtschaftsneudeutsch so unschön heißt) geopfert werden. Was einmal eingestürzt ist, läßt sich nur mit sehr hohen Kosten wieder aufbauen, das Original aber ist für immer verloren. Deshalb muß das Deutsche National-Theater seine Selbständigkeit in allen Sparten behalten, diese Breite braucht es, um dem ihm bestimmten Platz in der deutschen Theaterlandschaft einnehmen zu können.
Titelthema: Zum 70. Geburtstag von Armin Müller (W. Kirsten, G. Gerstmann)
- Prosa: Armin Müller, Albrecht Börner, Martin Stade
- Lyrik: Armin Müller, Johanna Lüdde, Jenny Feuerstein, Uljana Wolf, Holger Uske, Benita Gleisberg, Silke Dokter, Christine Bosse
- Essay: Wulf Kirsten
- Interview: Albrecht Börner/Drehbuchautor (D. Ignasiak)
- Literaturgeschichte: Johann Matthäus Meyfart (D. Ignasiak), Johann Wolfgang von Goethe (K. Müller), Willibald Alexis (R. Stangenberger), Erwin Strittmatter (W. Voigt)
- Verlags- und Buchgeschichte: Frommann-Verlag (G. Schmidt)
- Städte: Arnstadt, Coburg, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
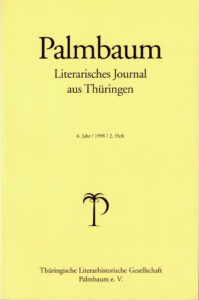
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 22
EDITORIAL
Weimar ist 1999 europäische Kulturstadt, was jeder weiß. Daß der kleinen thüringischen Stadt diese Ehre zuteil wurde, weil Goethes 250. Geburtstag zu feiern ist, scheinen manche aus dem Blick verloren zu haben. An die Stelle der toten Dichter sollen die lebenden rücken, das läßt uns das diesjährige Kunstfestmotto wissen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber es ist auch nicht sonderlich originell. Schon Brecht wußte: »Aus nichts wird nichts, das Neue kommt aus dem Alten, aber deswegen ist es doch neu.« Das Dilemma ist nur: Die Touristen kommen wegen der toten Dichter nach Weimar. Schon 1871 befand Staatsminister Theodor Stichling: »Unsere Zukunft liegt in der Vergangenheit«. Wenn Weimar leben will (was auch an Arbeitsplätze denken läßt), muß es ein Museum sein. Deshalb wird in Weimar gebaut, umgebaut, alles so hergerichtet, als sei die Zeit stehengeblieben. Nur wenn alles so aussieht, wie es immer ausgesehen hat, kommen die Besucher. Allein als Museum kann Weimar aber keine Kulturstadt sein, würde es immer mehr zu einem Disneyland der (möglicherweise immer weniger werdenden) Bildungsbürger mutieren. Ein Widerspruch in sich, den sich Weimars Kulturmanager stellen müssen, manchmal auch gegen das schon immer traditionell ausgerichtete eigene Publikum. Das erfuhr auch schon Harry Graf Kessler, dem unser Titel gewidmet ist.
Ein bemerkenswertes »Weimar«-Buch kündigt für Ende August der Insel Verlag an. Sigrid Damm legt ein Buch über Christiane und Goethe vor, das das Ergebnis einer langen Recherche ist. Wer glaubte, im Umfeld Goethes kann nichts Neues mehr entdeckt werden, irrt. Neues ist hier aus dem Alten hervorgegangen. Das Buch scheint das Ereignis des Herbstes zu werden. Wir freuen uns, unseren Lesern schon jetzt einen Auszug bieten zu können und bedanken uns bei der Autorin und beim Insel Verlag. Der Stoff scheint zu interessieren und zu reüssieren. Auch Regisseur Egon Günther (»Lotte in Weimar«) hat sich dieses Themas angenommen und mit der Verfilmung der Goetheschen »Ehe« begonnen. Der Streifen soll «Die Braut« heißen, die Vorlage lieferte der Jenaer Schriftsteller Albrecht Börner. Im nächsten Heft sprechen wir mit ihm und drucken einen Auszug aus seiner Filmerzählung. Bis dahin wünscht die Redaktion allen Lesern einen schö-
nen Sommer.
Titelthema: Harry Graf Kessler (J.-F. Dwars, H. Schillo)
- Prosa: Sigrid Damm, Matthias Biskupek, Stefan Raile
- Lyrik: Thomas Spaniel, Liane Bosse, Bernd Dittrich, Klaus Brückner
- Essay: Jörg Bernhard Bilke, Dietmar Jacobsen, Niels Kahlefendt
- Interview: Sigrid Damm/Schriftstellerin (U. Kaufmann), Gerhard Schuster/Präsident Stiftung Weimarer Klassik (H. Stade)
- Literaturgeschichte: Johann Wolfgang von Goethe/Friedrich Schiller (A. Reimann), Novalis (G. Kraft)
- Philosophiegeschichte: Friedrich Nietzsche (G. Schaumann)
- Städte: Altenburg, Bad Tennstedt, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
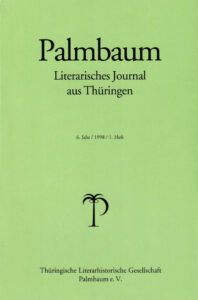
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 21
EDITORIAL
Obwohl Bertolt Brecht kaum Berührungen zu Thüringen gehabt und er vermutlich das Land nie besucht hat, war uns sein 100. Geburtstag am 10. Februar dennoch Anlaß genug, den Dichter ins Titelthema des 21. Palmbaum-Heftes zu rücken. Interessant hätte es sein können, den Weg der Theaterstücke Brecht durch Thüringen zu verfolgen. Immerhin gehörten in den 20er Jahren Gera und Jena zu den ersten deutschen »Provinz«-Orten, die den jungen und umstrittenen Autor gespielt haben. In den 50er Jahren sind es dann die Theater von Meiningen und Weimar, an denen Fritz Bennewitz Brechts Stücke gegen manchen Widerstand auf die Bühne bringt, die den Dichter in der DDR durchsetzen helfen. Bekanntlich war das Berliner Ensemble (!) lange Zeit das einzige Theater der DDR, auf dem Brecht gespielt wurde. Jungen Autoren, deren Werke nicht auf die Bühne kamen, empfahl Brecht deshalb lakonisch, sich doch gefälligst ein eigenes Theater anzuschaffen, wenn sie gespielt werden wollten.
In unserem Titelthema haben wir aber andere Brecht-Spuren verfolgt. So wird ein Dichter, der vor allem als Autor von Kinderbüchern Furore machte, und ein Germanist, der als Klassik-Interpret ein Namen hat, zum Werk Brechts in Beziehung gesetzt. Dem einen wurde in Jena gerade eine Ausstellung gewidmet, bei dem anderen hat man damit begonnen, den Nachlaß zu sichten.
Lassen Sie uns noch eine Bemerkung in eigener Sache nachschicken: Jetzt liegen fünf abgeschlossene Jahrgänge unserer Zeitschrift vor. Das ist für ein Periodikum, das der Literatur dient, viel. Dem Verlag war dieses kleine Jubiläum Anlaß, ein Register drucken zu lassen, das einem Teil der Auflage beigelegt wurde. Dem 48 Seiten umfassenden Heft ist zu entnehmen, daß in den 20 erschienenen Nummern fast 220 Autoren, die meisten davon aus Thüringen, zu Wort kamen. 123 von ihnen sind Schriftsteller im engeren Sinne, 56 vorrangig Lyriker, 37 Prosaschreiber, 18 Essayisten, 4 Kinderbuchautoren und nur 3 Dramatiker, 5 veröffentlichten in einer der in Thüringen gesprochenen Mundarten. Zu dieser stattlichen Bilanz gehören auch 130 rezensierte Bücher und fast 50 literarisch gewürdigte Orte. – Wenn auch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel knapper geworden sind, und eine literarische Zeitschrift läßt sich nicht völlig ohne Zuschüsse herstellen und vertreiben, wollen wir mit unserer Arbeit fortfahren und an weitere fünf Palmbaum-Jahrgänge glauben.
Titelthema: Zum 100. Geburtstag von Bertolt Brecht (H. Heydrich, U. Kaufmann)
- Prosa: Wolfgang Haak, Heide Haßkerl, Anne L. Kneip
- Lyrik: Frank Willmann, Maik Lippert, Jenny Feuerstein, Achim Schiller, Gerda Maria Arndt
- Essay: Harald Gerlach, Dietmar Jacobsen
- Mundart: Wolfgang Eppler, Richard Fischer
- Autoren der Gegenwart: Kurt Kauter (D. Fechner)
- Literaturgeschichte: Johann Christian Günther (D. Ignasiak), Henriette von Pogwisch (S. Kaufmann), Ernst Wagner (A. Svoboda), Heinrich XLV. Reuß (W. Schilling)
- Städte: Gera, Gotha, Jena, Schmalkalden, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
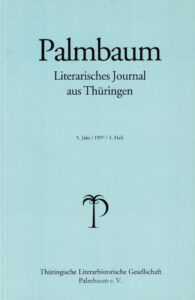
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 20
EDITORIAL
Heinrich Heines 200. Geburtstag war zweifellos das wichtigste Dichter-Jubiläum des zu Ende gehenden Jahres. Sieht man von dem Fauxpas um die Heine-Briefmarke einmal ab, verlief es wenig spektakulär. Darin unterschied es sich von früheren Heine-Jubiläen. Schon jetzt kann man sagen: So unumstritten wie zu seinem 200. Geburtstag war der Dichter in seinem Vaterland noch nie. Das läßt uns hoffen. Doch wir wollen sein Werk auch nicht in die klassische Unverbindlichkeit herabsinken sehen. Heine ist ein lebendiger Dichter.
Ein anderer deutscher Poet wurde in diesen Tagen doppelt so alt. Im Unterschied zu Heine genoß er zu Lebzeiten eine geradezu göttliche Verehrung. Sein 400. Geburtstag fand allerdings kaum Beachtung, auch nicht bei den Briefmarkenverantwortlichen. Das Interesse an ihm scheint nur noch historisch zu sein. Dabei gibt es von ihm auch bleibende Verse. »Nie stille steht die Zeit / der Augenblick entschwebt / und den du nicht genutzt / den hast du nicht gelebt.« Das ist schon klassische Lebenshaltung, und den Alexandriner-Vers verdankt die deutsche Literatur ihm. Wie der Dichter so ist auch die östliche Landschaft, der er entstammt, historisch geworden. Sowohl das schlesische Bunzlau, wo Martin Opitz geboren wurde, als auch das hanseatische Danzig, in dessen prächtigster Kirche sich sein Grab befindet, sind heute polnische Städte. Deshalb fragen wir in diesem Heft auch nach dem Umgang mit ostdeutscher Kultur.
Als sich in Deutschland die von Opitz vorgegebenen poetischen Formen in der Klassik vollendeten, bildete sich – teilweise an den gleichen Orten – mit der Romantik ein neues Poesieverständnis, manche sehen in ihrem Aufstieg sogar den Beginn der Moderne. 1998 und 1999 stehen wichtige Romantik-Jubiläen ins Haus. Im Palmbaum werden wir auf sie zu sprechen kommen. In diesem Heft finden Sie mit Gisela Kraft dazu schon eine gewichtige Stimme aus Thüringen.
Erlauben Sie uns noch eine Nachbemerkung. Mit dieser Ausgabe halten Sie den zwanzigsten Palmbaum in Händen. Insgesamt sind in den vergangenen fünf Jahren unter diesem Titel mehr als 2500 Seiten bedruckt worden. Selbst die Redakteure haben nicht mehr alle Beiträge im Blick. Eine Zusammenschau täte also Not. Im nächsten Heft werden Sie daher eine Bibliographie als Beilage finden. Vielleicht lassen Sie sich von den nüchternen Übersichten zum Zurückblättern
einladen?
Die Herausgeber
Titelthema: Zum 250. Geburtstag von Johann Karl Wezel (H. Henning, H. Bärnighausen)
- Prosa: Anne L. Kneip
- Lyrik: Hans-Jörg Dost, Manfred Thiele, Roswitha Höfer
- Essay: Dagmar Hirsch
- Interview: Edoardo Costadura/Übersetzer (W. Kirsten), Karl-Heinz Meyer/Vorsitzender der J.-K.-Wezel-Gesellschft (U. Görl)
- Autoren der Gegenwart: Erwin Strittmatter (W.-D. Stapelfeld), Hansgeorg Stengel (G. Gerstmann)
- Literaturgeschichte: Kurt Kläber (H. Heydrich)
- Verlags- und Buchgeschichte: Friedrich Justin Bertuch (S. Seifert)
- Städte: Greiz, Jena, Saalfeld, Sondershausen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
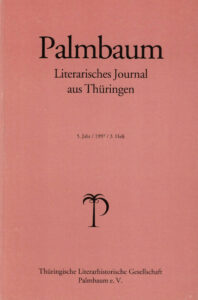
Heft 19
EDITORIAL
Am 20. Oktober besteht die Thüringische Literarhistorische Gesellschaft Palmbaum e. V auf den Tag genau fünf Jahre. Das ist keine lange Zeit. Deshalb ist uns das Jubiläum auch nicht Anlaß zu großen Reden. Der Verein beging es vom 2. bis 4. Oktober mit einer wissenschaftlichen Konferenz im Bibliothekssaal des Erfurter Augustinerklosters. Das Thema war »Thüringische Residenzkultur vom 16. bis zum 19. Jahrhundert«. 24 Wissenschaftler haben dort gesprochen, sie kamen aus ganz Deutschland, zwei sogar aus den USA. Daß die Resonanz so groß war, freut uns sehr.
Diese Tagung war bereits die vierte, die der Palmbaum durchführte. Die Referate der dritten Tagung liegen nun in dem Sammelband »Beiträge zur Geschichte des Buchdrucks und des Buchgewerbes in Thüringen« vor. Herausgegeben wurde der zweihundert Seiten starke Band von Detlef Ignasiak und Günter Schmidt. Er ist der erste der Studienreihe »Palmbaum Texte. Kulturgeschichte«. In ihr sollen Sammelwerke und Monographien zu Themen aus der Kulturgeschichte Mitteldeutschlands erscheinen. Zwei weitere sind bereits in Vorbereitung.
Im vorliegenden 19. Palmbaum-Heft wird im Titel an einen bedeutenden Thüringer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts erinnert, an Johann Karl Wezel, dessen 250. Geburtstag vom 31. Oktober bis zum 2. November in Sondershausen im Rahmen der 7. Wezel-Tage festlich begangen wird. Aufmerksamkeit wird vor allem das Internationale Svmposion finden, an dem Wezel-Forscher aus Europa und Amerika teilnehmen werden. Ihren Abschluß finden die Wezel-Tage mit Aufführungen im Liebhabertheater des Sondershäuser Schlosses.
Heure sieht die Literaturwissenschaft in dem Sondershäuser Autor »den politisch radikalsten – und wagehalsigsten – Dichter der Spätaufldärung« (Philipp McKnight). Viele Schriftsteller der Gegenwart, so Arno Schmidt und Einar
Schleef, sahen in Wezels Leben eine Metapher für unangepaßtes Künstlertum schlechthin.
Titelthema: Martin Opitz und die thüringischen Barockdichter (D. Ignasiak)
- Prosa: Gisela Kraft, Elisabeth Dommer, Harald Schleuter
- Lyrik: Harald Gerlach, Holger Uske, Renate Montag, Günter Ullmann, Ines Klonz, Gino Hahnemann
- Essay: Lutz Rathenow, Günter Schmidt
- Literaturgeschichte: Tannhäuser (H. Weigel), Friedrich Schlegel (P. Kösling), Wolfgang Borchert (H. Heydrich)
- Städte: Eisenach, Erfurt, Jena
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
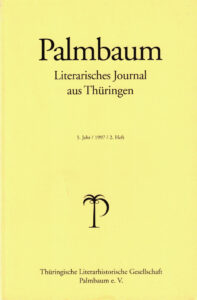
Einbandgestaltung Dietrich Kühn, Wartburg-Verlag
Heft 18
EDITORIAL
Vor 200 Jahren begann eine ungewöhnlich enge Zusammenarbeit Goethes und Schillers. Über den Sommer hin entstanden die wichtigsten Balladen. Am 20. Juli 1797 schrieb Goethe an Schillers Freund Körner: »Sie haben durch Schillern erfahren, daß wir uns jetzt im Balladenwesen und Unwesen herumtreiben. Die seinigen sind ihm, wie Sie schon wissen, sehr geglückt; ich wünsche, daß die meinigen einigermaßen darneben stehen dürfen; er ist zu dieser Dichtart in jedem Sinne mehr berufen als ich.« Was vor allem Schiller in kurzer Zeit in Jena zu Papier brachte, wurde generationenlang bewundert: »Der Taucher«, »Der Handschuh«, »Die Kraniche des Ibykus«.
Bis in die allerjüngste Vergangenheit gehörten diese Balladen zum Lese- und Lernkanon deutscher Schulen. Verse daraus wurden zu geflügelten Worten, die Gedichte selbst oft parodiert, was allerdings nur Erfolg har, wenn das Original allgemein bekannt ist. Zu Lene Voigts Zeiten war das in Sachsen so.
Das Jenaer Theaterhaus, auf dessen Nachbargrundstück Schiller gewohnt hat, versuchte kürzlich eine Annäherung an den einstigen »Dichter der Jugend« und eröffnete mit seinem Spektakel »Finster, Schiller, finster« die diesjährige »Kulturarena«. Auch wir versuchen uns in diesem Heft am Balladen-Thema und lassen es von einer Literaturwissenschaftlerin, von einer Didaktikerin und einem Schriftsteller befragen.
Daß auch heute über Thüringer Schriftsteller deutschlandweit gesprochen wird, zeigen zwei bemerkenswerte Prosaarbeiten. Im Berliner Aufbau-Verlag erschien vor wenigen Wochen Harald Gerlachs Roman »Windstimmen«. Die Handlungsplätze liegen in den Grenzlandschaften Schlesien und Thüringen, die den Autor geprägt haben. Doch erscheinen sie im Licht der Jahrhunderte und damit außerhalb der Spannweite eines gewöhnlichen Entwicklungsromans. Im August wird im gleichen Verlag Landolf Scherzers Reportage »Der Zweite« in die Buchhandlungen kommen. Der Titel nimmt Bezug auf den Bestseller »Der Erste« von 1988. Damals hatte der Suhler Autor mit dem Porträt des SED-Kreissekretärs von Bad Salzungen eine ungewöhnliche Innenansicht aus dem Parteiapparat geliefert. Nach der Wende lag es nahe, ein ähnliches Buch über den aus dem Westen gekommenen Bundeswehroffizier und nunmehrigen Landrat desselben Kreises zu schreiben. Beiden Büchern sind auch im Westen viele Leser zu wünschen.
Titelthema: Klassische Balladen (A. Reimann, B. Straub)
- Prosa: Ines Eck, Lutz Rathenow, Bernd Dittrich, Volker Ebersbach, Elisabeth Dommer
- Lyrik: Gerhard Tänzer, Silke Dokter, Günter Ullmann
- Essay: Inge von Wangenheim, Joachim Walther, Matthias Biskupek
- Interview: Werner Keller/Präsident der Goethe-Gesellschaft (H. Stade), Herbert Rosendorfer/Schriftsteller (K. Agthe)
- Autoren der Gegenwart: Stephan Hermlin (M. Straub)
- Literaturgeschichte: Johann Wolfgang von Goethe/Friedrich Schiller (A. Reimann), Adele Schopenhauer (G. Büch), Louis Fürnberg (H. Nitzschke)
- Städte: Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
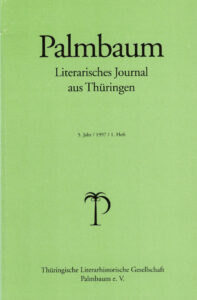
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 17
EDITORIAL
Das Titelthema dieses Heftes ist in besonderer Weise thüringisch, wenn endlich wieder einmal Mundartautoren zu Wort kommen und dieses Thema durch den Franken Klaus Gasseleder gewissermaßen von außen befragt wird. Südthüringen und Franken rücken damit enger aneinander. Mit Margarete Braungart stellen wir eine Autorin aus dem fränkisch geprägten Teil Thüringens vor.
Als unser Vorstandsmitglied Günter Schmidt Ende letzten Jahres Max Keßler, den hochbetagten Gründer des Wartburg Verlages, interviewte, ahnte die Redaktion noch nicht, daß dieser Beitrag gleichsam zu einem Nachruf auf das renommierte Thüringer Buchunternehmen geraten würde. Das Verlagshaus hat zwar noch nicht seine Gesamtexistenz aufgegeben, wohl aber seine Tätigkeit als Buchverlag. So steht er auch dem Palmbaum nicht mehr zur Verfügung. Wir bedauern dies um so mehr, als sich dieser Verlag in der mehr als einjährigen Zusammenarbeit als verläßlicher Partner erwiesen hat und jeder Verlagswechsel mit erheblichen Belastungen verbunden ist.
Um Veränderungen weitgehend auszuschließen, haben sich Vorstand und Redaktion in Absprache mit den Mitgliedern und den wichtigsten literarischen Institutionen auf ein Erscheinen im quartus-Verlag geeinigt. Da es sich bei ihm gewissermaßen um ein Kind des Palmbaum-Engagements handelt, hoffen wir, das Schiff weiter in ruhigen Gewässern steuern zu können.
Um die Zeitschrift noch fester in der thüringischen Literaturlandschaft zu verankern und Aktivitäten zu bündeln (was in Zeiten leerer Kassen überlebenswichtig ist), geben wir sie ab sofort in Verbindung mit dem Literaturbüro Thüringen e. V. heraus, dessen Gründungsmitglied der Palmbaum ist. Bleibt zu hoffen, daß in ein paar Monaten. wenn der Palmbaum fünf Jahre existiert, noch mehr Leser zu ihm gefunden haben. Statt auf 128 erscheint das Heft von nun an auf 136 Seiten, der Ladenpreis bleibt der gleiche, nur das Abonnement erhöht sich geringfügig. Am Niveau soll es keine Abstriche geben.
Die Herausgeber
Titelthema: Mundartdichtung (K. Gasseleder, F. Reinhold)
- Prosa: Thomas Alexander Schmidt, Gerd W. Heyse, Heide Hasskerl, Margarete Braungart
- Lyrik: Thomas Spaniel, Heiko Bätz, Günter Ullmann, Mira Ebendorff
- Mundart: Wolfgang Eppler, Günter Langhammer, H. Jürgen Heimrich
- Interview: Max Kessler/Verleger (G. Schmidt)
- Autoren der Gegenwart: Bodo Kühn (H. Nitzschke)
- Literaturgeschichte: Friedrich Wilhelm Gotter (K. Agthe), Karl Emil Franzos (K. Werner), Klaus Herrmann (H.-D. Tschörtner)
- Städte: Erfurt, Gotha, Rudolstadt, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
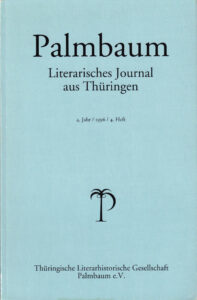
Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 16
EDITORIAL
Noch nie breitete der Palmbaum seine Blätter so weit aus: Diesmal rei-chen sie vom thüringischen Kernland über die Hermann-Hesse-Stadt Calw bis zu Versen mit Sansibar-Bezug und zur Slam-Poetry, die aus den USA auf Europa übergriff. Diese Spannbreite verdanken wir Thüringer Autoren unterschiedlicher Generationen und (Schreib-) Erfahrungen. Ihre Texte sind leichter in ein Heft als unter einen Hut zu bringen – und gewähren gerade dadurch Einblicke in die Vielfalt der gegenwärtigen Literatur. Das Nebeneinander verschiedener, bisweilen sogar konträrer Gestaltungsweisen mag manchen vor den Kopf stoßen – vielleicht wird diese Kollision aber zum Anstoß, sich probeweise auf andere Schreib- und Lebensentwürfe einzulassen.
Mit der Formulierung unseres Titelthemas haben wir es uns nicht leichtgemacht. Schließlich haben wir uns auf »Schreiben nach der Moderne« geeinigt. Die Künstler der Moderne, einst angetreten, mit dem klassischen Literaturkanon zu brechen, sind inzwischen selbst klassisch geworden. Die utopische Dimension der ästhetischen Avantgarde ist vorn Gang der Ge-schichte problematisiert (manche meinen: aufgezehrt) worden. Die Heutigen schreiben nach der Moderne, nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch im Sinn der Verfügbarkeit moderner Gestaltungsmittel.
Nicht jeder kann sich wie der Altmeister Goethe eine kreativitätsfördernde Flucht nach Italien leisten. Da ist es preiswerter – und gleichfalls anregend –, den Sprung in fremde Textwelten zu wagen. Freilich ist es abonnentenfreundlicher, das Bewährte zu bieten (und das tun wir ja auch), doch wenn man auf dem weihnachtlichen Gabentisch nur das Er-wartete fände, wäre die Überraschung dahin. Ein besinnliches Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr und gute Lektüre wünschen Ihnen
Die Herausgeber
Titelthema: Schreiben nach der Moderne (J. M. Paasch)
- Prosa: Wulf Kirsten, Ulman Weiß, Bernd Dittrich, Wally Eichhorn-Nelson
- Lyrik: Walter Werner, Holger Uske, Johanna Lüdde, Bernd Dittrich
- Interview: Frank Willmann/Dramatiker (H. Heydrich)
- Autoren der Gegenwart: Hildegard Jahn-Reinke (W. Horlitz), Alexander Jesch (D: Fechner)
- Literaturgeschichte: Gustav Adolf von Gotter (V. Ebersbach), Caroline von Wolzogen (Ch. Theml), Ottilie von Goethe (A. Reimann), Otto Ludwig (H. Nitzschke)
- Städte: Erfurt, Jena, Mühlhausen, Rudolstadt, Saalfeld, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 15
EDITORIAL
Thomas Mann, der sich anlässlich der Goethe-Gedächtniswoche im März 1932 in Weimar aufhielt und in der neuerrichteten Weimar-Halle über „Goethes Laufbahn als Schriftsteller« sprach, fühlte sich „eigenartig berührt« von der Vermischung einer nahezu grenzenlosen Hitler-Bewunderung mit naiv-sentimentalem Goethe-Kult. Erschüttert musste der spätere Autor von »Lotte in Weimar« feststellen: »Weimar ist ja eine Zentrale des Hitlertums. Überall konnte man das Bild von Hitler ausgestellt sehen. Der Typus des jungen Menschen, der unbestimmt entschlossen durch die Straßen schritt und sich mit dem römischen Gruß begrüßte, beherrschte die Stadt. Daneben fiel die festliche Ausstattung der Schaufenster ins Auge, manchmal ein wenig kindlich, teils rührend, wie Goethe in Marzipan, das Gartenhaus als Bonbonnière …«
Wenige Wochen später fanden in Thüringen Landtagswahlen statt, bei denen die Nationalsozialisten die absolute Mehrheit errangen. Fritz Sauckel wurde Ministerpräsident, das von ihm geführte Land wurde der Mustergau des Führers und Weimar seine Hauptstadt. Das »Jahrhundert der Extreme« fand in Thüringen eine frühe Erfüllung. Dabei hatte das Land jahrhundertealte liberale Traditionen, galt es wegen seiner strukturellen Sonderentwicklung als politisch ausgeglichen. Sollte dies nun alles keine Rolle mehr spielen? Viel zu wenig wurde bislang darüber nachgedacht, geforscht, öffentlich gemacht.
Wir haben die geistige Entwicklung Thüringens im ersten Drittel unseres Jahrhunderts zum Titelthema gewählt und dabei das Verhalten von Intellektuellen ins Zentrum gerückt. Das Thema eignet sich ebenso zum geschichtlichen Rückblick wie zu Fragen an die Gegenwart. In ihren Essays tun dies auf ganz unterschiedliche Weise Friedrich Schorlemmer und Lothar Baier. Zudem kommt durch ihre Beiträge ein von uns vernachlässigtes Genre zu seinem Recht.
Die Herausgeber
Titelthema: Nationalsozialistische Literatur und Heimatkunst (J.H. Ulbricht, B. Stenzel)
- Prosa: Siegfried Nucke
- Lyrik: Siegfried Nucke, Christian Heinick, Traute Gundlach
- Essay: Friedrich Schorlemmer, Lothar Baier, Harald Gerlach
- Autoren der Gegenwart: Günter Ullmann (G. Gerstmann)
- Literaturgeschichte: Friedrich Hebbel (K. Gasseleder)
- Verlags- und Buchgeschichte: Eugen-Diederichs-Verlag (G. Schmidt)
- Städte: Jena, Suhl, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg-Verlag
Heft 14
EDITORIAL
Nach dem Urteil des namhaften Marburger Barockforschers (und Palmbaum-Mitglieds) Jörg Jochen Berns gehört der Siegeszug des Pressewesens in Deutschland »zu den vitalsten – will sagen: folgeträchtigsten, geschichtsmächtigsten – Innovationen des an Erfindungen nicht eben armen 17. Jahrhunderts.« Die ältesten überlieferten deutschen Zeitungen sind 1609 in Straßburg (»Relation«) und in Wolfenbüttel (»Aviso«) gedruckt worden. Bis in die Zeit um 1700 wurden in nicht weniger als 50 deutschen Städten etwa 100 verschiedene Zeitungen gegründet. In unserem Titelbeitrag geht der Oldenburger Bibliothekswissenschaftler Walter Barton der Frühgeschichte des thüringischen Pressewesens nach. Vorläufer von Zeitungen gab es in Erfurt bereits vor 400 Jahren. Das Jubiläum ist uns Anlass, in diesem Heft über literarische Medien nachzudenken und den Bogen bis in die Gegenwart zu spannen. Freundlicher-weise haben sich einige Thüringer Schriftsteller bereit erklärt, ihre Meinung zu diesem Thema zu sagen. Mehr noch als das 400jährige Pressewesen haben die erst seit einem dreiviertel Jahrhundert existierenden elektronischen Medien auf das Denken eingewirkt und unser Rezeptionsverhalten beeinflusst. Dass die Möglichkeit zu einer freien Meinungsäußerung eine Grundvoraussetzung für eine volle Entfaltung der Medien ist, wissen wir als Zeitschriftenmacher nur zu gut. Ohne diese Voraussetzung gäbe es auch den Palmbaum nicht. Geben wir das letzte Wort dem Erfurter Dichter Kaspar Stieler, dem Zeitgenossen Herzog Friedrichs I. und Georg Neumarks (über die die anderen Beiträge zur Barockliteratur handeln) und Verfasser des Buches »Zeitungs-Lust und Nutz« (1695), der ersten theoretischen Abhandlung über das Pressewesen überhaupt. »Wir ehrlichen Leute. die wir jetzt in der Welt leben, müssen auch die jetzige Welt erkennen: Die Zeitungen sind der Grund, die Anweisung und Richtschnur aller Klugheit, und wer die Zeitung nicht achtet, der bleibt immer und ewig ein elender Prülker (also Nichtskönner) und Stümper in der Wissenschaft der Welt und ihrem Spielwerk.«
Die Herausgeber
Titelthema: 400 Jahre Nachrichtendruck in Thüringen (W. Barton)
- Prosa: Landolf Scherzer, Matthoas Bikupek, Hubert Schirneck, Lutz Rathenow
- Lyrik: Hubert Schirneck, Gino Hahnemann, Lutz Rathenow
- Dramatik: Bernd Dittrich
- Essay: Harald Heydrich
- Interview: Hanns Cibulka/Dichter (G. Gerstmann)
- Literaturgeschichte: Georg Neumark (M. Ludscheidt), Friedrich I. (R. Jacobsen)
- Städte: Bad Langensalza, Erfurt, Gotha, Jena, Mühlhausen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Dietrich Kühn, Wartburg Verlag
Heft 13
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser, mit dem vorliegenden Heft halten Sie die dreizehnte Ausgabe des Palmbaum in Händen. Unser literarisches Journal erscheint jetzt in dem 1946 in Jena gegründeten und seit 1993 in Weimar ansässigen Wartburg Verlag. Von Anfang an regionalgeschichtlichen Themen und Thüringer Autoren gleichermaßen verbunden, hoffen wir auf eine gute Zusammenarbeit und auf die Unterstützung des Verlages für unser Anliegen.
Dieser Wechsel wurde am Ende des vergangenen Jahres notwendig, weil Vereinsvorstand und Redaktion im Palmbaum eine Zeitschrift sehen, die für alle Thüringer Autoren offen ist. Freilich kommt keine Redaktion ohne Auswahl aus den wachsenden Textangeboten aus. Ein wesentliches Kriterium soll – und zwar stärker als bisher – die ästhetische Qualität sein.
Auch weiterhin sollen die Beiträge einerseits literatur- und kulturgeschichtlich ausgerichtet sein, andererseits die gegenwärtige Literaturentwicklung in Thüringen vorstellen und kritisch begleiten. Diese Triade von Tradition, Gegenwart und Thüringen-Bezug wird der Zeitschrift auch in Zukunft ihre eigene Spezifik verleihen. Doch will der Palmbaum mehr als bisher unterschiedliche Leserinteressen bedienen. Dabei sollen auch Autoren anderer Gegenden zu Wort kommen und nach und nach neue Themenbereiche erschlossen werden. Alle Veränderungen werden darauf ausgerichtet sein, den Palmbaum als Medium der interessanten. unterhaltenden kulturellen Bildung, als Forum des Austauschs, des Dialogs und des kulturvollen Streits zu entwickeln.
Die Herausgeber
Titelthema: Novalis und Thüringen (V. Ebersbach)
- Prosa: Siegfried Pitschmann, Ines Eck
- Lyrik: Hans Arnfried Astel, Christoph Eisenhuth, Katharina Glanz, Dietmar Beetz
- Interview: Michael Knoche/Bibliotheksdirektor (H. Völkerling)
- Autoren der Gegenwart: Herbert von Hintzenstern (D. Ignasiak), Wolfgang Hilbig (D. Jacobsen)
- Literaturgeschichte: Martin Luther (D. Ignasiak), Heinrich Mann (V. Wahl), Jura Soyfer (H. Heydrich)
- Städte: Meuselwitz, Bad Tennstedt, Eisenach, Jena, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
Inhalt
Editorial (7)
Paul Elgers: zwei historische Erzählungen
Die Unterredung (10)
Im Schatten Napoleons (15)
Beiträge zum literarischen Werk und seiner Wirkung
Helmut Nitzschke: Historischer Romancier und verdienstvoller literarischer Mentor (22)
Hans Richter: Der »Johanna«-Roman erscheint heute wertvoller als zuvor. Paul Elgers und sein Lesepublikum (30)
Günter Gerstmann: Philosophische Gelassenheit ist am Platze.
Ein Gespräch mit Paul Elgers (36)
Stimmen von Weggefährten
Werner Barth: Dieser Roman ist ein Stück unserer Geschichte (52)
Matthias Werner Kruse: Mit dem blauen Löwen zum roten Greif
in Rudolstadt (53)
Armin Müller: Es existieren noch ein paar Fotos aus dieser Zeit (57)
Johanna Hoffmarm: Der Greif hat mich nicht gefressen (59)
Albrecht Börner: Drei Begegnungen (61)
Bodo Baake: Entfernte Nähe (65)
Glückwünsche von Wolfgang Held und Hanns Cibulka (67)
Paul Elgers’ historische Romane im Spiegel der Kritik
Jungfrau Johanna 1973 (70)
Marta Feuchtwanger: Brief an Paul Elgers (75)
Der Fall Kaspar Trümpy – 1976 (76)
Masaniello – 1987 (79)
Bibliographie zum literarischen Werk von Paul Elgers (83)
Die Beiträger (87)
Editorial
Paul Elgers begeht am 23. März 1995 seinen 80. Geburtstag. Seit gut drei Jahrzehnten lebt der Schriftsteller in Rudolstadt – unweit des Schlosses Heidecksburg, wo der Greifenverlag seinen Sitz hatte. Diesem traditionsreichen Thüringer Buchunternehmen, das Karl Dietz gegründet und bis zu seinem Tod geleitet hat, stand der Jubilar einige Jahre als Cheflektor vor. Damals hat er entscheidend dazu beigetragen, daß der gute Name des Verlagshauses erhalten blieb. Er förderte eine Reihe junger Autoren und ebnete ihnen den schwierigen Weg ins literarische Leben. Seit seinem Ausscheiden aus dem Greifenverlag lebt Paul Elgers als freier Schriftsteller. Nahezu alle seine Bücher sind im Greifenverlag erschienen. Alle bereicherten sie die literarische Landschaft Thüringens – und viele von ihnen wirkten weit über sie hinaus.
Die Erinnerungen an diese Zeit dürfen nicht vergessen werden. Den Weggefährten und Freunden des Schriftstellers ist deshalb zu danken, wenn sie den Geburtstag von Paul Elgers zum Anlaß nahmen, um Erinnerungen an die gemeinsame Arbeit mit dem geschätzten Kollegen niederzuschreiben und Leseeindrücke festzuhalten. Damit leisteten sie einen Beitrag, daß Leben und Werk des Autors, dieses tapferen »Wahrheitssuchers«, nicht in eine selbstverschuldete »Geschichtslosigkeit« fallen. Der Herausgeber ist daher allen Autoren, die Beiträge für diese Geburtstagsgabe beisteuerten, zu großer Dankbarkeit verpflichtet.
Nicht minder gilt diese auch Herrn Dr. Detlef lgnasiak, dem Vorsitzenden der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e. V., der das Vorhaben, für Paul Elgers eine solche Publikation herauszubringen, vorbehaltlos unterstützte und nach Kräften förderte.
Günther Gerstmann

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 12
EDITORIAL
Man muss es vermutlich immer wieder sagen: Der Palmbaum fühlt sich nicht nur dem literarischen Leben der Zeit verpflichtet, sondern dem ganzen vorangegangenen Jahrtausend thüringischer Text- und Buchgeschichte. So verstehen wir auch unseren Untertitel »Literarisches Journal«. Damit ist der Palmbaum also nicht eine von 78 deutschen Literaturzeitschriften, sondern sie ist eine der wenigen – wie etwa »Literatur in Bayern« – mit diesem aufgezeigten breitgefächerten Profil.
Das Titelthema ist diesmal der scheinbar untergegangenen Welt des Märchens gewidmet. Märchenschreiben hat ja in Thüringen eine große Tradition. Johann Karl August Musäus, der Zeitgenosse der Weimarer Klassiker, gilt als der erste deutsche Kunstmärchendichter, er schreibt lange bevor das wiederentdeckte Genre eine Domäne der Romantiker wird. Dennoch ist das abgedruckte Novalis-Märchen, in Thüringen entstanden, wenig bekannt. Im nächsten Heft wird der Leipziger Autor Volker Ebersbach den Spuren Novalis’ in Thüringen folgen.
Am 21. Dezember gedenkt man in Wiehe an der Unstrut des 200. Geburtstages Leopold von Rankes, des Begründers der modernen Geschichtsschreibung. Aus diesem Anlass wird das 1952 geschlossene Museum wiedereröffnet werden. Mit seiner Zielvorstellung »ich will nur zeigen, wie es wirklich war« ebnete er der quellenkritischen Methode den Weg, widersprach aber auch dem von Marx und Hegel vertretenen Entwicklungsgedanken. Sein Grundsatz »Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott« lässt es nicht zu, bestimmte Epochen der Geschichte zu favorisieren. Auch deshalb konnte man in der DDR mit Ranke nicht viel anfangen. Im nächsten Heft kommen wir auf dieses Jubiläum – wie auf das bevorstehende Lutherjahr – zurück.
Die Herausgeber
Titelthema: Märchen und Märchenerzählen (D. Fechner, M. Straub)
- Prosa: Rainer Hohberg, Matthias Biskupek
- Lyrik: Hildegard Jahn-Reinke, Harry Weghenkel, Silke Dokter, Karlheinz Schmedding, Günter Ullmann
- Interview: Christoph Nix/Theaterintendant (F. Quilitzsch)
- Autoren der Gegenwart: Einar Schleef (J. Wolf)
- Literaturgeschichte: Christoph Martin Wieland (R. Montag), Maximilan von Goethe (J. Klauß), Minchen Herzlieb (I.-M. Barton),
- Städte: Apolda, Jena, Nordhausen, Weimar
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 11
EDITORIAL
Seit dem Erscheinen des letzten Heftes starben drei bedeutende Thüringer Autoren: Hildegard Jahn-Reinke, Paul Elgers, Walter Werner. Paul Elgers konnten wir noch anlässlich seines 80. Geburtstages im März mit einem Sonderheft ehren, Hildegard Jahn-Reinke konnte noch mit Freude den letzten PALMBAUM mit ihren Gedichten in Händen halten. Völlig unvorbereitet erschütterte uns der Tod von Walter Werner. Dass sich der lange geplante Abdruck seiner neuen Gedichte zu einem Nachruf gestaltet, schmerzt sehr.
Im Zentrum des vorliegenden Heftes stehen Schriftsteller aus der Landschaft zwischen Rhön und Thüringer Wald. Die erstmalige Erwähnung des Henneberger Landes vor 900 Jahren wird im nächsten Jahr Anlass sein, über die kulturelle Rolle Südthüringens erneut nachzudenken. Wie kein anderer in unserem Jahrhundert hat Walter Werner dieser Landschaft seine poetische Stimme verliehen. Landolf Scherzer ist von dort in die Welt aufgebrochen und mit vielgelesenen Reportagen zurückgekehrt. Jüngere wie Friedrich Engelbert und Holger Uske veröffentlichten seit den achtziger Jahren, stießen aber bald auf Schwierigkeiten. In diesem Heft soll thematisiert werden, dass literarisches Leben in Thüringen nicht nur in Erfurt, Weimar und Jena stattfindet.
An der Stelle, wo Sie sonst, liebe Leserin, lieber Leser, das Titelthema finden, informieren wir Sie über ein diffamierendes Presse-Interview, dazugehörende Presseartikel und ihre Aufnahme bei unseren Autorinnen und Autoren. Als leise Zeitschrift wollte sich der PALMBAUM nicht in die lauten Debatten einmischen, und schon gar nicht in die vor und hinter den Kulissen geführten Schlammschlachten. Dennoch ist der PALMBAUM ins Gerede gekommen. Der Verleger bat deshalb die Redaktion darum, den Beiträgen dieses Heftes ein »Palmbaum-Dossier« voranstellen zu dürfen, um so den ungeheuerlichen Anwürfen zu begegnen.
Die Herausgeber
Titelthema: Thüringische Literarhistorische Gesellschaft Palmbaum e. V.
- Prosa: Landolf Scherzer, Hanns Cibulka, Gerd W. Heyse, Holger Uske
- Lyrik: Walter Werner, Friedrich Engelbert, Holger Uske
- Interview: Cläre Werner/Burghauptmännin der Wachsenburg (C. Hobohm)
- Literaturgeschichte: Kaspar Stieler (B. Igel), Rudolf Baumbach (A. Seifert), Johannes R. Becher (J.-F. Dwars), Rennsteiglied (R. Montag)
- Städte: Arnstadt, Eisenach, Jena, Meiningen, Suhl
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 10
EDITORIAL
Mit dem vorliegenden Heft halten Sie, verehrte Leserinnen und Leser, die 10. Ausgabe des Palmbaum in der Hand. Jede erschien mit wenigstens 128 Seiten. Hinzu gesellten sich vor kurzem noch zwei Sonderhefte. Weitere sollen in unregelmäßigen Abständen folgen.
Seit der 1. Nummer im Frühjahr 1993 sind 27 Lyriker, 18 Epiker, 1 Dramatiker und 3 Mundartautoren zu Wort gekommen. Alle Beiträger fühlen sich mit Thüringen verbunden, die meisten leben im Lande. Sie gehören allen Schriftstellergenerationen an. Die Geburtsjahre liegen zwischen 1904 und 1975! Auch in Zukunft sollen sich im Palmbaum Autoren unterschiedlichen Alters und völlig verschiedener Handschriften zu Wort melden. Wie die Redakteure des Palmbaum glauben auch die Autoren an den festen Platz von schöngeistiger Literatur im Kulturbewusstsein der Öffentlichkeit.
Schon in den 50er Jahren wollten Kritiker das »Ende der Gutenberg-Galaxis« herbeireden und ein Szenario aufbauen, in dem es keine klassische Lese-kultur mehr gäbe, Bibliotheken nur noch Museen der Schriftkultur sein sollten und in den Buchhandlungen kaum mehr bedrucktes Papier zu haben sei. Inzwischen ist die Entwicklung rasant vorangeschritten. An die Stelle vieler Bücher sind digitale Datenträger gerückt. Haben Bücher, hat die Lesekultur überhaupt noch eine Chance? Ist sie ein Relikt einer untergehenden Welt? Mit unserem Titelthema »Bibliotheken in Thüringen« wollen wir damit beginnen, solche Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Helfen Sie uns dabei durch Ihre Diskussionsbeiträge.
Die Herausgeber
Titelthema: Bibliotheken in Thüringen (K. Marwinski, R. Montag, M. Ludscheidt)
- Prosa: Wolfgang Held, Gabriele Stötzer, Bärbel Klässner
- Lyrik: Hildegard Jahn-Reinke, Renate Montag, Rolf Tänzer, Christian Heinick, Gabriele Stötzer
- Interview: Bernd Kauffmann/Kulturmanager (H. Stade)
- Literaturgeschichte: Alfred Edmund Brehm (D. Ignasiak), Marthe Renate Fischer (M. Rothen), Johannes R. Becher (J.F. Dwars)
- Städte: Erfurt, Jena, Saalfeld, Stadtroda, Weimar

Einband-Hain-Team
Heft 9
EDITORIAL
Seit 50 Jahren schweigen in Mitteleuropa die Waffen. Das nationalsozialistische Deutschland, dass diesen verlustreichsten und grausamsten europäischen Krieg begonnen hatte, wurde von den alliierten Streitkräften besiegt. Ende April fiel die Reichshauptstadt, kurz darauf erfolgte die bedingungslose Kapitulation, die Völker Europas atmeten auf. In Thüringen begann der Frie-den schon einige Wochen früher; am 1. April hatte General Patron die Werra bei Creuzburg überschritten. Das Land wurde amerikanisch, im Juli dann, wie in Jalta beschlossen, russisch. Was in dem Vierteljahr der US-Besetzung geschah, ist hierzulande immer noch wenig bekannt. Die Amerikaner als Befreier passten nicht so recht ins verordnete Geschichtsbild. Die Redaktion bat Thomas A. Seidel von der Evangelischen Akademie Thüringen, diesem Thema aus seiner ganz persönlichen Sicht nachzugehen.
Die Deutschen mussten diesen Krieg teuer bezahlen, doch nicht alle gleichermaßen. Die Hauptlast hatten die Deutschen östlich von Oder und Neiße zu tragen. Millionenfacher Tod, Vertreibung, Verlust der Heimat. Einige der damals Vertriebenen sind heute thüringische Schriftsteller: Armin Müller, Harry Thürk, Harald Gerlach, um nur drei zu nennen. So unterschiedlich ihre Lebens-läufe und ihre Schreibweisen, das schlesische Thema ist ihnen gemeinsam. Und mit dem Abstand, so scheint es wenigstens, ist es sogar stärker geworden.
Im vorliegenden Heft werden mit Johann Christian Günther und Gustav Freytag zwei schlesische Schriftsteller vorgestellt, die im 18. und im 19. Jahrhundert nach Thüringen kamen. War der Aufenthalt in unserem Land für ersteren nur eine Episode, wenn auch eine besonders tragische, so hat der andere hier kräftige Spuren hinterlassen. Obwohl schon vor hundert Jahren gestorben, werden mit seinem nicht unumstrittenen Werk auch Fragen diskutiert, die auf das mit uns Deutschen verbundene Unheil in unserem Jahrhundert verweisen.
Die Herausgeber
Titelthema: Zum 100. Todestag von Gustav Freytag (J. Matoni)
- Prosa: Paul Elgers
- Lyrik: Ursula Martin, Hanns Cibulka, Annelies Paul, Traute Gundlach
- Dramatik: Frank Willmann
- Mundart: Günter Langhammer
- Essay: Thomas A. Seidel
- Literaturgeschichte: Johann Christian Günther (H. Gerlach), Friedrich Schiller (K. Steinhaußen)
- Verlags- und Buchgeschichte: Theodor Lockemann (W. Barton)
- Städte: Gotha, Jena, Rudolstadt
Palmbaum-Sonderhefte
Das Eigene und das Fremde
Literaturtage in Weimar 1994, hg. von der Literarischen Gesellschaft Thüringen
Prosa: Harald Gerlach, Wolfgang Hilbig, Dieter Lattmann, Siegfried Pitschmann, Ines Eck
Lyrik: Horst Samson, Hubert Schirneck, Brigitte Struzyk
Paul Elgers zum 80. Geburtstag
1995, hg. von G. Gerstmann
Prosa: Paul Elgers
Essays: Helmut Nitzschke, Hans Richter, Günter Gerstmann, Armin Müller, Albrecht Börner, Bodo Baake
Der Autor und seine Provinz
Deutsch-Polnisches Autorentreffen 2001, hg.von M. Straub und K. Agthe
Prosa: Jerzy Lukosz, Gisela Kraft, Iwona Mickiewicz, Matthias Biskupek, Jens-Fietje Dwars, Wulf Kirsten, Kai Agthe
Essays: Henryk Bereska, Annerose Kirchner, Gabriela Matuszek, Bärbel Klässner, Maria Kolenda, Boguslaw Zurakowski, Karol Maliszewski, Stefan Szymutko
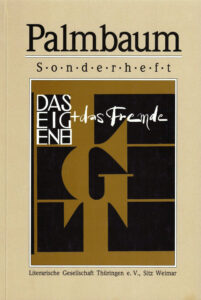
Einbandgestaltung: Hain-Team
Inhalt
Vorwort (7)
Jörn Halbe: Das nahe Fremde. Und das ferne –
Hamilton oder Die Straße nach B. (9)
Carmen Francesca Banciu: Das strahlende Gett (35)
Zehra Çirak: Vater und Mutterwitz. Gedichte (43)
Ines Eck: Auszüge aus dem Roman
»Steppenwolfidyllen« (53)
Harald Gerlach: Fortgesetzte Landnahme
oder Wo der Weltkrieg wirklich begann (63)
Wolfgang Hilbig: Der Geruch der Bücher (75)
Dieter Lattmann: Jonas aus dem großen Fisch (85)
Siegfried Pitschmann: Eigentlich wollte David M.
nach Norden fliegen. Ein Fragment (95)
Horst Sarnson: Lieb Vaterland. Gedichte (111)
Hubert Schimeck: Die Bevölkerung der Bäume. Gedichte (123)
Brigitte Struzyk: Die vergifteten Brötchen von Weimar (131)
Die Autorinnen und Autoren (139)
Vorwort
Wiederum legt die Literarische Gesellschaft Thüringen die Texte der Thüringer Literaturtage in gedruckter Form vor.
Es waren bereits die 4. Literaturtage, die am 6. und 7. Mai 1994 im Weimarer Volkshaus stattfanden. Zum Thema »Das Eigene und das Fremde« versammelten sie Lesungen, Vorträge, eine offene Werkstatt, zahlreiche Schullesungen, Treffen, ein Podiumsgespräch, Diskussionen und ein Familienprogramm. Seit Gründung der Gesellschaft sehen wir unsere Aufgabe darin, Menschen im Umkreis der Literatur zusammenzubringen, Gespräche und gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. Dieser fortlaufende Diskurs scheint uns wichtig zu sein in einer Umwelt, die manche entmutigt und verstummen läßt, andere in Isolation und Verbitterung treibt. Lebendiges Gespräch, nicht abreißende Kommunikation kann diesem Prozeß entgegensteuern, kann beitragen zu einer Kultur der Verständigung und Selbstverständigung. Schriftstellerinnen und Schriftstellern ein Auditorium zu bieten, ist unser erklärtes Anliegen.
Auch diesmal – wie schon anläßlich der früheren Literaturtage – haben wir uns auf ein Thema konzentriert, in dem wir die gesellschaftlichen Probleme wie in einem Brennspiegel gebündelt sahen. »Das Eigene und das Fremde« drängte sich uns auf in einer Zeit, in der Ausländerheime brennen, Andersdenkende ausgegrenzt werden und andererseits Inländer auf der schwierigen Suche nach einer neu zu beschreibenden Identität sind.
Auch im Jahr 1994 gelang es, vielfältige Stimmen, nahe und ferne, zu einem Chor zu vereinen, der durch Vertiefung und Öffnung zugleich diejenigen beeindruckte, die in Weimar dabeisein konnten.
Die Qualität und Originalität der vorgetragenen Texte hat uns auch in diesem Jahr dazu bestimmt, sie in gedruckter Form zusammenkufassen, um sie einer breiten Leserschaft vorstellen zu können, aber auch, um die aufgeworfenen Fragen und Kontroversen über den Tag hinaus fruchtbar zu machen. Wir legen hiermit ein Werk vor, in dem das Gespräch zwischen »Thüringen« und der »Welt«, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Eigenem und Fremdem aufgeblättert werden kann. Und vielleicht entdeckt der Leser, was zuvor schon manchen Hörer überrascht hat: Daß das Fremde naherückt und das vermeintlich Nahe befremdlich wird.
Die meisten der hier abgedruckten Texte wurden am 6. und 7. Mai in Weimar vorgetragen, einige wenige waren zu lang oder ließen sich nicht aus einem Gesamtkomplex herauslösen – in solchen Fällen baten wir die Autoren um einen anderen Text. Wir danken allen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihren Verlagen für die Genehmigung, ihre Texte abdrucken zu dürfen, und empfehlen dieses Buch der freundlichen Aufmerksamkeit von Lesern in Thüringen und anderswo.
Der Vorstand

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 8
EDITORIAL
Noch bevor das frühneuzeitliche Thüringen literarische Bedeutung erlangt, macht es durch den hohen Stand der Pädagogik auf sich aufmerksam. Als Teil der religiösen Kultur ist diese neue Disziplin der Humaniora von Anfang an eng mit der entstehenden literarischen Kultur verknüpft. Die frühen Gymnasien in Gotha, Pforta, Coburg, Gera und Schleusingen sind lebendige Pflegestätten der Literatur. Führende Thüringer Pädagogen schreiben nicht nur fürs Fach, sondern haben für ihre Bücher ein großes Publikum im Auge. Dabei ist vor allem an Christian Gotthilf Salzmann zu denken, der vor 250 Jahren geboren wurde. Im Titelbeitrag versuchen mehrere Beiträger sein Werk aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Populär blieb auch Friedrich Wilhelm August Fröbel. 1839 eröffnet er in Blankenburg eine »Spiel- und Beschäftigungsanstalt« für Kinder. Für diese neue pädagogische Institution eine geeignete Bezeichnung suchend, teilt er bald mit: »Ich hab’s gefunden, Kindergarten soll ihr Name sein.«
Diese schöne, weil menschlich warme Wortschöpfung geht schnell in viele Sprachen ein. Gegenwärtig sind die Deutschen allerdings dabei, sich von ihr zu verabschieden: sie ersetzen sie durch den bürokratischen Begriff Kindertagesstätte oder – noch schlimmer – Kita, was fast so herzlos ist, wie die vorfröbelsche Kinderbewahranstalt. Ein Wunder nur, dass dafür kein englisches Wort herhalten muss. In der Zeit läge es auf jeden Fall.
Reinhard Lettau, der jahrelang in den USA lebte, beobachtete die Deutschen in ihrem Sprachverhalten sehr genau. 1978 glossierte er im literarischen Jahrbuch »Tintenfisch«: »Nachdem dieses Volk fast alles, was an ihm schön, liebenswürdig und zart war, verraten hat, verliert es nun auch seine Sprache. Ganz Deutschland scheint nichts als ein ununterbrochener englischer Sprachkurs.« Der in Erfurt geborene Autor ist Beiträger dieses Heftes und lässt sich über Thüringen und anderes befragen.
Die Herausgeber
Titelthema: Christian Gotthilf Salzmann (F. Lindner, W.D. Schellmann)
- Prosa: Reinhard Lettau, Frank Quilitzsch, Stefan Raile
- Lyrik: Friedrich Engelbert, Ulf Christian Hasenfelder, Lutz Mühlfriedel, Renate Siebenhaar, Damaris Kaufmann
- Interview: Reinhard Lettau/Schriftsteller (F. Qulilitzsch)
- Autoren der Gegenwart: Harald Gerlach (H. Stade)
- Literaturgeschichte: Voltaire (D. Ignasiak), Friedrich Schiller (U. Steinhaußen), Johann Daniel Falk (H. von Hintzenstern), Theodor Fontane (R. Montag), Buchenwald (G. Sauder)
- Städte: Gotha, Jena, Rudolstadt, Tabarz, Waltershausen, Weimar

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 7
EDITORIAL
Im Sommer 1644, mitten im Dreißigjährigen Krieg, wurde in Nürnberg der »Löbliche Hirten- und Blumenorden an der Pegnitz« gegründet. Im Unterschied zu den anderen im Barockzeitalter ins Leben getretenen literarischen Gesellschaften, darunter auch der ältere Weimarer „Palmenorden«, überdauerte die Nürnberger Gründung die Jahrhunderte und besteht jetzt genau 350 Jahre. Damit ist der »Pegnesische Blumenorden e. V.«, wie er sich heute nennt, der älteste Literaturverein Deutschlands. Als sich die Nürnberger Literaten 1644 um Georg Philipp Harsdörffer scharten, begannen in den Rathäusern von Münster und Osnabrück gerade die Friedensverhandlungen. Vier Jahre später, als im ganzen Heiligen Römischen Reich die Friedensglocken läuteten, haben sie das so lange erwartete Ereignis in ihren Dichtungen gefeiert. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Erschöpfung hatten die Pragmatiker einen Sieg über die Ideologen errungen. Die Vertreter aller Religionen mussten sich zu einem friedlichen Miteinander verpflichten und auf Ausgrenzungen ihrer früheren Gegner verzichten. Im Artikel 1 des Vertrages wurde – erstmals in der modernen Geschichte – das hehre Ziel verkündet: »Ein christlicher, allgemeiner Frieden sowie eine wahre und aufrichtige Freundschaft soll herrschen …« Ferner wurde die Obrigkeit beider Religionen dazu verpflichtet, »streng und hart zu verhindern, dass jemand öffentlich oder privat, durch Predigt, Lehre oder Schrift, aufgrund seiner Gesinnung oder seiner Taten im Kriege angegriffen oder gedemütigt werde«. Da anders als bei seinen prominenten Nachfolgern auf dem Westfälischen Friedenskongress nicht die Sieger über die Besiegten zu Gericht saßen, war solches möglich. Die Zeitgenossen, allen voran die Dichter, sahen darin einen Ausdruck neuen politischen Denkens und die Ergebnisse selbst als ein Zeichen Gottes zur Vergebung.
Die Herausgeber
Titelthema: Eugen Diederichs und Friedrich Nietzsche (U. Diederichs)
- Prosa: Jutta Hecker
- Lyrik: Gabriele Stötzer, Lutz Rathenow, Thomas Spaniel
- Literaturgeschichte: Carl Ludwig von Knebel (J. Klauß), Marlitt (G. Merbach), Lisa Tetzner (C. Amlacher), Buchenwald (G. Sauder)
Eckart Krumholz (R. Montag) - Städte: Arnstadt, Jena, Weimar

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 6
EDITORIAL
Es ist heute nirgendwo leicht, Bücher zu machen, noch schwerer wohl, sie zu verkaufen. In den neuen Bundesländern kommen spezifische Probleme hinzu. Dennoch gibt es gerade hier etliche Menschen – sind es nun Idealisten oder einfach Querköpfe? –, die neue Verlage gründen. Felix Weigner, jetzt in Rudolstadt zu Hause, ist einer von ihnen. Immerhin hat sich der aus der Schweiz kommende alte und neue Verleger auf literaturträchtigem Terrain niedergelassen, in dem seit 1663 Bücher verlegt werden und zu fast allen Zeiten bedeutende Autoren zu Hause waren. Auf die Idealisten und Querköpfe angesprochen, lächelt Felix Weigner und schüttelt den Kopf, als ehemaliger Leiter der Greifenverlag GmbH i. G. half er mit, den Skandal um unterschlagene Gelder aufzudecken. Er erlebte damit im letzten Sommer hautnah ein Stück »Wild-ost« und wisse also, was es heiße, das Abenteuer Verlagsgründung zu wagen. Wäre es da für ihn nicht logischer gewesen, seine Zelte in Thüringen abzubrechen und in die Schweiz zurückzukehren, wo er jahrelang Programmleiter beim Jugendbuchverlag Aare und vorher für das Schweizer Büro der deutschen Ernst Klett Verlage zuständig war? »Die Menschen in Thüringen haben mich nicht enttäuscht«, sagt er immer wieder, »es waren die Glücksritter, die die ungefestigten Verhältnisse hier ausgenutzt haben.« Inzwischen hat Felix Weigners Hain Verlag seine Buchproduktion aufgenommen, die ersten Werke sind erschienen. Er hat damit Zeichen gesetzt, dass er es mit Thüringen und seiner reichen Kulturlandschaft ernst meint. Dazu gehört auch sein Engagement für unsere Zeitschrift.
Die Herausgeber
Titelthema: Der Bund zwischen Goethe und Schiller (G. Horn, V. Hesse)
- Prosa: Wolfgang Held, Hans Lucke, Matthias Biskupek
- Lyrik: Joachim Lehmann, Christoph Eisenhuth
- Interview: Wulf von Lucius/Verleger (G. Schmidt, D. Ignasiak)
- Literaturgeschichte: Johann Wolfgang von Goethe (M.-L. Kahler), Johann Gottfried Herder (H. von Hintzenstern), August von Kotzebue (D. Jacobsen), Oskar Maria Graf (U. Kaufmann),
- Philosophiegeschichte: Ernst Haeckel (G. Schmidt)
- Verlags- und Buchgeschichte: Gustav-Fischer-Verlag (G. Schmidt)
- Städte: Jena, Weimar

Einbandgestaltung: Hain-Team
Heft 5
EDITORIAL
Den PALMBAUM gibt es heuer seit einem Jahr. Mit der vorliegenden Nummer liegen fünf Hefte vor, jedes davon mit mehr als 120 Seiten. Allesamt sind es Hefte zum Lesen, und da-bei wird es auch in Zukunft bleiben, auch wenn die Zeitschrift mit diesem Heft ein neues Layout erhalten hat und in einem Verlag erscheint. Die PALMBAUM-Gründer wussten von Anfang an, auf welches Wagnis sie sich einließen. Ein Skeptiker sprach sogar davon, dass es wohl leichter sei, die hundertste Biersorte auf den Markt zu bringen als nur eine einzige thüringische Literaturzeitschrift. Der PALMBAUM ist zwar auch nach einem Jahr noch nicht allerorts zu finden, wie der Leserkreis ist aber auch die Anzahl der Städte, wo man ihn kaufen kann, von Heft zu Heft gewachsen. Der PALMBAUM hat inzwischen Abonnenten in allen Bundesländern, in Frankreich und in den USA. Die Redaktion hat also gute Gründe weiterzumachen. Sie kann Dank sagen bei vielen, die an das Unternehmen glaubten und seine Finanzierung sicherten und weiter sichern. Erfreulich ist auch, dass sich immer mehr Buchhändler entschließen, die Zeitschrift anzubieten, obwohl mit ihr nur wenig zu verdienen ist.
In diesem Jahr ist in Thüringen bedeutender literarischer Persönlichkeiten zu gedenken: Männer wie Christian Gotthilf Salzmann, Johann Gottfried Herder oder Friedrich Nietzsche haben runde Geburtstage. Und vor 200 Jahren fanden Goethe und Schiller in Jena zu einem Arbeitsbündnis zusammen. Die Thüringische Literarhistorische Gesellschaft PALMBAUM e. V., zu der jetzt über hundert Mitglieder gehören, wird aus diesem Anlass am 16. Juli in Jena eine kleine Konferenz veranstalten und in ihrer Reihe EDITION PALMBAUM zu diesem Thema ein Lesebuch heraus-geben. Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele PALMBAUM-Freunde diese Angebote annehmen.
Die Herausgeber
Titelthema: Der Kyffhäuser (D. Ignasiak, M. Platen, S. Weigelt)
- Prosa: Hans-Jörg Dost, Ines Eck, Gerd W. Heyse, Frank Quilitzsch
- Lyrik: Günter Ullmann
- Interview: Hans-Joachim Maaz/Sozial-Psychologe (G. Gerstmann)
- Autoren der Gegenwart: Mundart in Thüringen (H. Sperschneider)
- Literaturgeschichte: Jenaer Schnapphans (D. Ignasiak), Karoline Paulus (Ch. Theml), Otto Ludwig (R. Gauß), August Trinius (D. Ignasiak), Rahel Sanzara (M. Werner),
- Germanistikgeschichte: Heinz Stolte (R. Stolte),
- Städte: Bad Frankenhausen, Eisfeld, Jena, Waltershausen
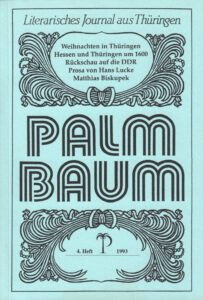
Einbandgestaltung: Gerlinde Böhnisch-Metzmacher
Heft 4
EDITORIAL
Am 5. November fiel die Entscheidung: Weimar wird 1999, im Jahr des 250. Geburtstages seines bedeutendsten Bürgers, »Kulturstadt Europas« sein. Mit seinen 60.000 Einwohnern ist die Ilm-Stadt die kleinste von allen bisherigen »Kulturstädten«, doch ist sie mindestens genauso geschichtsträchtig wie die anderen, nur widersprüchlicher, polarer und damit sehr deutsch. Die »Iphigenie« wurde ungefähr dort das erste Mal gespielt, wo in unserem Jahrhundert ein Stück Hölle erdengegenwärtig war. Schlimmer noch: Nicht wenige der Peiniger von Buchenwald hatten Goethes Bekenntniswerk auf dem Humanistischen Gymnasium gelesen.
Was vermag da eigentlich Literatur? Auf jeden Fall und immer wieder: sie vermag Hoffnungszeichen zu setzen und Vertrauen zu stiften. Die Brüsseler Entscheidung ist sicherlich ein Vertrauensbeweis an das Volk Goethes, natürlich auch eine Referenz an den »besonderen Ort«, der Weimar jahrhundertelang war. Bedeutend war die Stadt gerade deshalb, weil dort Kulturperspektiven entwickelt wurden, die weithin ausstrahlten. 1999 muss Weimar sich nicht nur als Bewahrerin des Guten und Schönen zeigen, auch als Erneuerin, deren Signale Aufnahme finden können, in ganz besonderem Maße in Osteuropa, wo man sich den Werken der deutschen Klassiker traditionsgemäß besonders nahe fühlt.
Goethe selbst fühlte sich nicht nur mit Weimar verbunden. Ohne seine Aufenthalte in Jena, vor allem nach seiner Rückkehr aus Italien, als ihm die Residenzstadt und ihr Hofleben besonders eng und zurückgeblieben erschienen, konnte er in der benachbarten Universitätsstadt ungestört und gesammelt tätig sein. Damals dichtete er in den »Zahme(n) Xenien« die bekannten Verse:
»Wohin willst du dich wenden?«
Nach Weimar-Jena, der großen Stadt,
die an beiden Enden
viel Gutes hat.
Weimars Oberbürgermeister Büttner, glücklich über die Nachricht aus Brüssel, möchte »die alte Achse Weimar-Jena noch weiter beleben«, wie er in einem Interview gegenüber der TLZ verlauten ließ. Der PALMBAUM möchte das im nächsten Jahr zu begehende Jubiläum der Wiederbegegnung Goethes mit Schiller im Juli 1794 in Jena zum Anlass nehmen, ihn darin zu bestärken und nach Kräften zu unterstützen. Wenn auch nach dieser denkwürdigen Begegnung am Jenaer Markt kein inniges Freundschaftsverhältnis entstand, ein intensives Arbeitsbündnis ging daraus allemal hervor. Was für ein Glücksfall für die deutsche und europäische Kulturgeschichte! Die Beziehungen von Künstlern untereinander sind gewöhnlich andere, wie auch die Weimarer Geschichte lehrt.
Die Herausgeber
Titelthema: Musik- und Theaterkultur um 1600 in Thüringen (D. Ignasiak)
- Prosa: Hans Lucke
- Lyrik: Renate Montag, Ursula Martin
- Essay: Götz Planer-Friedrich, Matthias Biskupek
- Autoren der Gegenwart: Jutta Hecker (R. Montag)
- Literaturgeschichte: Jenaer Liederhandschrift (H. Endermann), Quirinus Kuhlmann (J. Judersleben), Johann Karl Wezel (H. Bärnighausen)
- Germanistikgeschichte: Hans Richter (H. Heydrich)
- Verlags- und Buchgeschichte: Greifen-Verlag (G. Gerstmann)
- Philosophiegeschichte: Friedrich Nietzsche (A. Emmrich),
- Städte: Jena, Rudolstadt, Schmalkalden, Sondershausen, Weimar
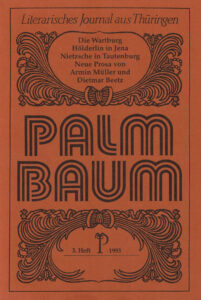
Heft 3
EDITORIAL
Daß Landgraf Hermann I., unter dessen Herrschsft Thüringen zu einer Großmacht herangewachsen war, wie Großherzog Carl August von Sachsen- Weimar und Eisenach, der Freund Goethes, und Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, dessen Theater europäischen Ruhm erwarb, zu den Thüringer Fürsten gehört, über die man heute noch spricht, hängt vermutlich mit dem verklärenden Bild zusammen, daß Richard Wagner von ihm in seiner romantischen Oper »Tannhäuser und Der Sängerkrieg auf der Wartburg« (1845) gezeichnet hat. Dabei spielt es keine Rolle, daß das historische Vorbild des Eisenacher Landgrafenhofes von den Vorstellungen der Romantiker und der durch sie initiierten literarischen Darstellungen überlagert wird. Nicht der machtbewußte Politiker Hermann ist im öffentlichen Bewußtsein lebendig geblieben, sondern der großzügige Förderer der Künste, gleichsam als Vor- läufer der großen fürstlichen Mäzene des 18. und 19. Jahrhunderts. Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und Eisenach ließ ab 1838 mit großem materiellem Aufwand und überzeugendem ideellem Engagemant die nur als Ruine überkommene Wartburg als eine Einheit von historischem Bauwerk und erinnerungsschwerem Geschichtsmonument wiedererrichten. Damit schuf er nicht nur das protestantische Gegenstück zu der in der gleichen Zeit entstandenen Walhalla des Bayernkönigs Ludwig I., sondern auch ein Denkmal deutscher und thüringischer Größe, das gleichermaßen an den sagenhaften Sängerkrieg, an Luthers Bibelübertragung und an den nationalen Aufbruch durch die Burschenschaften erinnert. Mit dieser unverwechselbaren Aura wird die bekannteste deutsche Burg im 19. Jahrhundert zugleich zu einem markanten Chiffre für Kunstsinn und dem damit verbundenen politi- schen Selbstbewußtsein. Victor Scheffel, der Lieblingsdichter des deutschen Bildungsbürgers und biedere Verfasser des »Trompeter von Säckingen« – einer der meistgelesenen Texte des 19. Jahrhunderts – hat diesen Stoff anläßlich der Vermählung des weimarischen Erbprinzen Carl August auf seine Weise zu einem Festspiel gestaltet (zu dem Franz Liszt die Musik komponiert hat) und damit der Zeitstimmung Ausdruck verliehen. Wenn uns dieser Text – den wir als Faksimile in diesem Heft erstmals wieder abdrucken – auch fremd vorkommen mag, unser Wartburg-Verständnis spiegelt er in seiner historischen Phantasie aber noch immer!
Titelthema: Der Sängerkrieg auf der Wartburg (S. Weigelt)
- Prosa: Armin Müller, Dietmar Beetz
- Lyrik: Klaus Steinhaußen
- Interview: Armin Müller/Dichter (G. Gerstmann), Effi Biedrzynski/Goethe-Forscherin (H. Stade)
- Autoren der Gegenwart: Stephan Hermlin (K. Werner), Jutta Hecker (R. Montag), Hans Richter (H. Heydrich), Rosemarie Schuder (D. Fechner), Volker Braun (J.-F. Dwars)
- Literaturgeschichte: Tobias Adami (D. Ignasiak), Friedrich Schiller (Ch. Theml), Johann Daniel Falk (P. Saupe), Friedrich Hölderlin (U. Fritsch)
- Philosophiegeschichte: Friedrich Nietzsche (G. Schaumann, J.-F. Dwars),
- Städte: Eisenach, Jena, Weimar
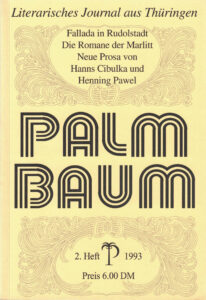
Einbandgestaltung: Gerlinde Böhnisch-Metzmacher
Heft 2
EDITORIAL
Das erste Heft des PALM BAUM ist vor drei Monaten erschienen und freundlich aufgenommen worden.
Die Herausgeber – allesamt erstmals damit beschäftigt, ein literarisches Journal zu erarbeiten – mußten einsehen, daß es nicht leicht ist, ein neues Periodikum auf den Markt zu bringen, zumal es gängige Klischees nicht bedienen will. Deshalb wird es noch schwerer sein, den PALMBAUM auch durchzusetzen. Die Herausgeber hoffen deshalb auf die Fürsprache der Leser, die bereits Gefallen an dieser neuen Literaturzeitschrift gefunden haben. Der PALMBAUM braucht Freunde, die ihn weiterempfehlen.
In seinem Rezensions- und Berichtsteil will der PALMBAUM seiner Chronistenpflicht Genüge tun und zum Bücherlesen auffordern, Tagesaktualität kann er aber auch in dieser Rubrik nicht anstreben, was allerdings nicht heißt, daß er auf aktuelle Fragen und Probleme nicht reagieren will. Das Gegenteil soll der Fall sein. Der PALMBAUM will das gegenwärtige literarische Leben kritisch begleiten, mit den unterschiedlichen Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen und vor allem den Lehrern und der Schuljugend wichtiges Informationsmaterial liefern. In einer von den elektronischen Medien beherrschten Zeit wäre es besonders interessant, eine Diskussion über die Umsetzung von literarischen Werken im Deutschunterricht zu führen oder über Schultheater- Aufführungen, wie sie an manchen Schulen erfreulicherweise wieder Tradition zu werden scheinen (siehe dazu unseren Beitrag zu einer Aufführung an einer Jenaer Schule), zu reden.
Als die vor einigen Wochen verstorbene Thüringer Schriftstellerin Inge von Wangen-heim zu Jahresbeginn von der Gründung der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft PALMBAUM e. V. und von dem Zeitschriftenvorhaben hörte, schrieb sie an den Vereinsvorsitzenden: »Zum ersten meine herzliche Gratulation zur Gründung der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft! Ebenso erfreulich ist der PALMBAUM. Endlich gibt es eine Publikation dieser Thematik, die meinem Wunschtraum entgegenkommt, die geistesgeschichtliche Kontinuität des klassischen Humanismus zu sichern, zu festigen, nicht zuzulassen, daß das alles kopfüber und ‑unter auf der Mülldeponie landet. Ausreißer, Umschmeißer, Zurücknehmer und zage Zweifler haben wir ja genug… Wir werden unseren Widerstand gegen diese ignorante Zerstörungswut des Horrors und der Kinderpornos nicht aufgeben und wenigstens unsere kleine Gemeinde der Wissenden und Empfänglichen fest zusammenhalten.« Wenn die Herausgeber auch nicht jedes dieser streitbaren Worte unterstreichen wollen, fühlen sie sich aber doch dem Anliegen Inge von Wangenheims zutiefst verpflichtet und der Autorin über den Tod hinaus verbunden.
Die Herausgeber
Titelthema: Auf dem Weg nach Deutschland. Ein Nachruf für Inge von Wangenheim (Helmut Nitzsche)
- Neue Prosa: Hanns Cibulka, Harald Heydrich, Henning Pawel, Karin Richter
- Rückschau: Die Bücherverbrennung
- Lyrik: Ingo Cesaro
- Feature: Paul Elgers
- Literaturgeschichte: Gerhard Schaumann, Cornelia Brauner
- Mundart: Hildegard Heinert
- Rezensionen: Reiner Kunze, Ingeborg Stein, Jens‑F. Dwars, Günter Merbach, Hans Richter, Ulrich Kaufmann
- Der Palmbaum berichtet: Sylvia Weigelt, Hedwig Völkerling, Erik Stephan
- Medienkonzentration und Monopolbildung auf dem Thüringer Zeitungsmarkt
- Der Palmbaum stellt vor: Günther Schmidt – Interview mit A. Kühn; Gisela Horn zum 65. Geburtstag von Helmut Brandt
- Der Palmbaum erinnert: Justus Jonas, Johann Bielcke, Friedrich Christoph Perthes, Carl August, Walter Stranka
- Thüringer Literaturkalender
- Litera-Tour durch Thüringen: Stormmuseum Heiligenstadt, Theodor Storm
- Die Palmnuss. Das literarische Preisrätsel
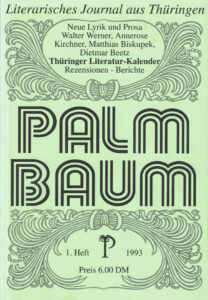
Einbandgestaltung: Gerlinde Böhnisch-Metzmacher
Heft 1
EDITORIAL
Das literarische Journal PALMBAUM, dessen erstes Heft Sie in der Hand halten, wird von der im Oktober 1992 in Jena gegründeten Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft PALMBAUM e. V. herausgegeben. Das Fehlen eines thüringenspezifischen literarischen Periodikums ist schon oft festgestellt und beklagt worden, nicht zuletzt von den hier lebenden Schriftstellern. Die vorliegende Zeitschrift will diese Lücke schließen. Sie fühlt sich gleichermaßen den reichen literarischen Traditionen verpflichtet wie dem gegenwärtigen literarischen Leben in Thüringen.
Mit ihrem Namen ruft die Zeitschrift die 1617 in Weimar nach italienischem Vorbild gegründete Fruchtbringende Gesellschaft in Erinnerung, deren Emblem die Palme war. Die Herausgeber haben allerdings nicht die Absicht, diese erste deutsche Akademie ins Leben zurückzurufen, vielmehr wollen sie deutlich machen, daß das durch die Jahrhunderte geprägte geistige Antlitz Thüringens nicht vorstellbar ist ohne den Einfluß anderer Länder und Kulturen. Der PALMBAUM will nicht allem regionale Interessen vertreten – so wichtig diese im einzelnen auch sind und in der vorliegenden Zeitschrift ihren Platz haben – sondern das literarische Sprachrohr einer vielgestaltigen europäischen Kulturlandschaft sein, wie wir sie gerade in Thüringen vorfinden. Aus diesem Grunde wird der Titelbeitrag des PALMBAUM immer einem literarhistorischen Thema gewidmet sein, das diesen Ansprüchen genügt.
Der PALMBAUM steht als Podium allen Autorinnen und Autoren Thüringens offen, darüberhinaus aber auch allen Beiträgern, die sich mit dieser deutschen Herzlandschaft verbunden fühlen. Wie selten in einer literarischen Zeitschrift werden im PALMBAUM Schriftsteller u n d Literaturwissenschaftler in engem Verband das Wort führen, sollen Gegenwartsliteratur und Literaturgeschichte spannungsvoll nebeneinander stehen und ein farbiges und hoffentlich lebendiges Bild von Thüringen vermitteln.
Die Herausgeber
Titelthema: Kompt / Lernt vom Palmbaum
- Lyrik: Walter Werner, Klaus Werner über Walter Werner, Johann Wolfgang Goethe, Annerose Kirchner, Günter Gerstmann über Günter Ullmann
- Das klassische Weimar: Sigrid Lange, Jochen Klauß, Christiane Vulpius
- Prosa: Matthias Biskupek, Gustav Luthardt, Dietmar Beetz
- Rezensionen
- Berichte: Hendrik Bärnighausen über die Wezel-Tage in Kassel und Sondershausen, Ulrich Kaufmann über J.M.R. Lenz, Albrecht Börner über ein Podium der Wortkunst, Detlef Ignasiak über ein Arbeitstreffen zur Geschichte der Literatur in Thüringen, Das Jenaer Theaterexperiment, Nachrichten aus dem literarischen Leben
- Der Palmbaum stellt vor: Winfried Haun über Leopold Hartmann, Sylvia Weigelt über Heinz Sperschneider, Stefan Pannen über Jens Henkel, Frank Lindner über Leben und Kunst
- Der Palmbaum erinnert: Detlef Ignasiak an Martin Rutilius, Roswitha Jacobsen an Veit Ludwig von Seckendorff, Gudrun Osmann an Fritz Reuter, Detlef Ignasiak an Georg Bötticher
- Thüringer Literaturkalender (1. Teil)
- Litera-Tour durch Thüringen: Martin Seifert über das Baumbachhaus Meiningen, Rudolf Baumbach: Der Wagen rollt
- Die Palmnuss (Nr. 1)